Diese Theaterrezension startet mit dem Ende: Der Schlussapplaus vereinte das ganze Haus im Glück. Auf der Bühne standen glücklich leuchtende Schauspielende, staunend über die Begeisterung des Publikums. Das Publikum applaudierte glücklich und begeistert von der anrührenden Freude der Schauspielenden. In einem Moment des gemeinsamen Glücks schmolz alles zusammen.

Foto: Phillip Zwanzig
Wenn diese Finalbeschreibung annehmen lassen sollte, dass vorher ein harmonischer Theaterabend stattgefunden hat, der folgekonsequent mit einer harmonischen Verabschiedung endete, dann ist das ein Irrtum. Der Theaterabend war eine Herausforderung auf mehreren Ebenen, denn er erfüllte kaum eine der gängigen Konventionen, die ihrerseits die Erwartungen präfigurieren. Die Inszenierung „Mord im Regionalexpress“, die Milan Peschel zusammen mit dem RambaZamba-Ensemble – ein Ensemble, in dem Schauspielende mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten – auf die Bühne des inklusiven Berliner RambaZamba Theaters (RZt) gebracht hat, suggeriert mit ihrem Titel, dass im Regionalexpress ein Mord stattgefunden habe. Allerdings fehlt von einer Leiche („War es etwa ein Schauspieler in der Sinnkrise?“) jede Spur. Zwar sind die Umrisse eines menschlichen Körpers auf dem Bühnenboden nachgezeichnet, sie lassen sich aber nicht füllen. Aufgrund dessen bilden die Reisenden des Regionalexpress eine Sonderkommission, deren Kostüme Referenzen sowohl zum Krimiklassiker „Mord im Orientexpress“ von Agatha Christi, als auch zur Kriminalliteratur „Sherlock Holmes“ von Arthur Conan Doyle herstellen. Verfolgungsjagden, Schießereien und Rempeleien, vertont durch entsprechende Filmmusik, lassen vermuten, dass hier ein Kriminalstück mit Komödienanteilen gespielt werden könnte. Denn auch ein Blues Brother ist Mitglied der Sonderkommission. Aber bis zum Schluss ist unklar, was, warum, wozu und gegen wen hier ermittelt wird. Hieu Pham, Zora Schemm, Franziska Kleinert, Moritz Höhne, Christian Behrend, Joachim Neumann, Anil Merickan und Milan Peschel (als Ersatz für Jan Bülow) drehen und winden sich um ein Zentrum, das nicht existiert, obwohl es wieder und wieder motivisch durch Sprache zu bilden versucht wird. Kurzerhand benennen sie sich in „Sonderkommission für unlösbare Widersprüche“ um und führen ein weiteres Thema ein:

Foto: Phillip Zwanzig
Ein Bild sei verschwunden. Von der seitlichen, rechten Bühnenwand wird das zuvor angestrahlte Ölgemälde „Peter im Tierpark“, 66 x 46 cm groß, 1960 von Harald Hakenbeck gemalt, abgehängt, das bildfüllend den Vorschuljungen Peter in einer leuchtend blauen Jacke und einer Mütze mit Ohrenklappen zeigt. Im Hintergrund sind holzschnittartig kahle Stämme und Äste von Bäumen, zwei Wildschweine, ein Kamel und ein Pfau zu sehen. Über das Bild wird informiert, dass es zu den am häufigsten veröffentlichten und daher bekanntesten Motiven zeitgenössischer Malerei in der DDR zählt und 1967 eine Sonderbriefmarke von 25 Pfennig mit dem Motiv aufgelegt wurde. Allerdings verschwindet nicht das Bild, es wird zügig an seinen Platz an der Bühnenwand und in den Lichtspot zurückgehängt. Es fehlt Peter, Peters Porträt ist ausradiert, statt seiner ist nun eine weiße Fläche in der Form seines Körperumrisses zu sehen. Peters Verschwinden wird auf das Jahr 1991 datiert. Und wieder dreht und windet sich die Sonderkommission für unlösbare Widersprüche, diesmal um die Frage, wo Peter sein könnte (im Swimmingpool, zu Hause, im Theater, in einer Berliner Kneipe?) oder was Peter sein könnte (ein Bauarbeiter, ein Opernsänger, ein Schuster, ein Fußballspieler, ein Maler, ein Wirt, ein Tierpfleger?). Nicht enden wollende, assoziative Aufzählungen kreisen Peter ein, um ihn ausfindig zu machen und verlieren sich dabei in ausufernden Spekulationen. Auf die Fragen „Was hat das jetzt mit Peter zu tun?“ und „Wie wird das alles zusammengehalten?“ folgt nur noch ein weiterer Verweis und zwar auf „Peter und der Wolf“, dem Musikmärchen von Prokofjew, das 1972 von Rolf Ludwig bei Eterna eingesprochen wurde. „Was heißt das jetzt?“ fragt einer der Darsteller provozierend, setzt nächste Irritationen, diesmal zwischen der Bühne und dem Souffleur in Gang und macht damit deutlich, dass wir alle Behinderungen im Generieren und im Austausch von Sinn unterworfen sind.

Foto: Phillip Zwanzig
Zwischenzeitlich ist das Gemälde kurzzeitig in einem der vielen und sich vertauschenden Koffer der Reisenden a.k.a. Sonderkommission verschwunden, die sich nun auch noch zu einer Hehlerbande wandelt. Namen wie Harry Eisenbieger, Viktor Lustig, Freddy Falconetti, Charlie der Manager, Franziska Fröhlich und Benjamin Blümchen (und noch weitere) zirkulieren auf der Bühne, zusammen mit dem Versuch einer detailgetreuen Rekapitulation der anvisierten Bahnhöfe Berlins und Deutschlands: Wie in dem Klassiker der Merkspiele „Ich packe meinen Koffer…“ scheitert die Aufzählung der Reisestationen, meist sind es Alliterationen, also benachbarte Wörter oder Bestandteile von Zusammensetzungen, die mit dem gleichen Anfangslaut starten: „Ludwigslust – oder war es Lichterfelde?, Schwerin – Nein, Stralsund!“ Und immer wieder und wieder wiederholen dabei die Schauspielenden den Satz, dass es keine falsche Richtung gäbe, es dauerte höchstens etwas länger. Diese Iteration wird zu einem Running Gag und in dieser Funktion zu einem konstruktiven Moment des Stücks, das als solches aber grundsätzlich, selbst von den Schauspielenden infrage gestellt wird: Der Mord im Regionalexpress sei kein Mord, denn es gäbe keine Leiche und Peter sei aus dem Bild ausgestiegen. Eines Tages aber würde Peter wieder auftauchen – und damit implodiert selbst der Handlungsverlauf. Nicht nur existiert kein Thema, kein Motiv, kein physischer Körper und kein sachlicher Zusammenhang, es existiert auch ohne ein Ende kein Ereignisverlauf – und damit kein Stück? Die Geschichte „eines Verlusts von Biographie und Bedeutsamkeit, von einem Land und seinen Leuten, von vielen Orten“, wie Christian Rakow in seiner Rezension schreibt, der Abend „über das Ausradiertsein von ostdeutscher Erfahrung“, wie Rakow die beiden Körperumrisse auf dem Bühnenboden und in dem Bild an der Bühnenwand resümiert, kulminiert weder in einem erzählbaren Ende, noch in einem Zukunftsszenario.

Foto: Phillip Zwanzig
Als lauthals aus dem Ensemble die Frage gestellt wird, ob wir hier eigentlich in einem Theater oder auf einem Bahnhof seien und ob der Titel des Stücks [sic] überhaupt maßgeblich sei, weicht alles auf: Begleitet von einer Playlist aus Popsongs, Filmmusiken und Evergreens simulieren die Reisenden a.k.a. Sonderkommission a.k.a. Hehlerbande in ihrem Reisewagon aus OSB-Platten, der von ihnen zwischenzeitlich händisch mangels fehlender Drehbühne mehrfach um seine eigene Achse gedreht wurde, verschiedene soziale Begegnungsformate: sie feiern und tanzen, sie werfen mit Schallplatten um sich und spielen Dart, sie spielen Tischtennis, umarmen und freuen sich. Und sie halten sich der Reihe nach das ausradierte Peter-Bild kompensatorisch über ihre Gesichter. Diese Freude kulminiert in dem glücklichen Abschlussapplaus mit Bravo-Rufen aus dem Publikum. Oder existierte noch etwas dazwischen? Vermutlich …

Foto: Phillip Zwanzig
Nachtrag:
Post-Postdramatisches Theater, am Beispiel von „Mord im Regionalexpress“, von Milan Peschel & dem RambaZamba-Ensemble Berlin
Das Post-Postdramatische Theater folgt auf das Postdramatische Theater, das seit den 1990er Jahren eine performanceorientierte Variante des Theaters ausformuliert (hat). Der Begriff wurde maßgeblich durch die gleichnamige Publikation des Theaterwissenschaftlers Hans-Thies Lehmann von 1999 geprägt.
Das Post-Postdramatische Theater setzt die Arbeit das Postdramatischen Theaters fort und dreht dessen Kennzeichen an manchen Stellen weiter: Nicht nur werden der Plot und die Theatermechaniken zerlegt, es wird auch der Sinn dieses Zerlegens zerlegt. Diese Dekonstruktion der Dekonstruktion ist durch folgende Charakteristika geprägt (Ableitungen durch „Mord im Regionalexpress“, von Milan Peschel & dem RambaZamba-Ensemble):
- leere und leerbleibende Spuren
- keine sinnfälligen Referenzen
- Dezentrierung
- Themenersatz und Themenvervielfältigung
- Spekulationen
- Absurditäten
- Identitätswechsel
- Sprachverwirrungen
- Sprachverlust
- Grundskepsis gegenüber Sprache und Bedeutungsgewinnen (Semantik)
- Grundskepsis gegenüber Sprache als Kommunikationsinstrument für den Austausch von Informationen
- Präsenz von Körpersprache/n
- scheiternde Rekapitulationen
- Funktionswechsel
- Unsicherheiten
- Running Gags
- Logiklosigkeit
- Sinnentleerungen
- Verzettelungen
- Simulationen
- Redundanzen
- Wiederholungen
- Improvisationen
- Klamauk
- Slapstick
- Genrereferenzen, die ins Leere laufen
Im Ergebnis der De-Montage-Technik entsteht (k)ein Stück.
Mit: Christian Behrend, Jan Bülow, Moritz Höhne, Franziska Kleinert, Anil Merickan, Joachim Neumann, Hieu Pham, Zora Schemm
Bühne: Magdalena Musial, Kostüm: Nicole Timm, Dramaturgie: Juliane Koepp, Technische Leitung: Stephan Lux, Licht: Anton Seidlitz, Ton: Amir Arsalan Shiri Varnamkhasti, Regieassistenz: Dalina Schambach, Regiehospitanz: Jule Cichon, Kostümhospitanz: Courtney Dugan.
Weitere Rezensionen:
Barbara Behrendt: Ist das hier ein Theater oder ein Bahnhof?, 23.2.2025, in: rbb24, https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2025/02/kritik-mord-im-regionalexpress-ramba-zamba-theater.html
Thomas Irmer: RambaZamba Theater Berlin: Riesenspaß mit Hintersinn, in: Theater der Zeit, https://tdz.de/artikel/7294e1eb-a359-45ed-a22c-86e4702601ff
Peter Laudenbach: Wem hier nicht das Herz aufgeht, der hat keines, 24.2.2025, in: Süddeutsche Zeitung, https://www.sueddeutsche.de/kultur/rambazamba-theater-berlin-menschen-mit-behinderung-li.3206466?reduced=true
Ulrich Seidler: „Mord im Regionalexpress“: Mit Milan Peschel und den Rambazambas Bahnhof verstehen, 23.2.2025, in: Berliner Zeitung, https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/theater/mord-im-regionalexpress-mit-milan-peschel-und-den-rambazambas-bahnhof-verstehen-li.2301182
Vermutlich hätte ich meinen Text anders begonnen. Ich hätte über die acht Einzelkapitel der Ausstellung geschrieben, die in einer der früheren Abfertigungshallen des Flughafenhauptgebäudes Berlin Tempelhof, direkt am Platz der Luftbrücke, installiert und inszeniert wurden. Ich hätte die Aufteilung der Räume, die Choreografie und Dramaturgie der Abläufe, die Inhalte und Materialien und das kuratorische Konzept in der ca. 100 Meter langen, ca. 50 Meter breiten Halle und ca. 20 Meter hohen Halle analysiert. Ich hätte mich gewundert, dass in dieser historisch monumentalen Naziarchitektur, gebaut ab 1936, ein so sensibles, empfindliches und sensitives Thema eingebettet und performiert wurde. Ich wäre auf die Initiatoren und weitere Kontextfaktoren, wie die Finanzierung eingegangen und hätte machtkritisch die Motive der Ausstellung und die Vermittlungsdimension dekonstruiert. Aber das Thema verlangt Empathie ab, sowohl als affizierte Forderung der Ausstellungsmacher und Initiator*innen, als auch als perzeptive Emotion durch die Ausstellung und ihre kuratorische Inszenierung selbst – und es dehnt die Grenzen dessen, was eine Ausstellung „ist“. Daher setze ich früher an, über die Ausstellung „The Nova Exhibition Tempelhof“ in Berlin, die keine Ausstellung ist, zu schreiben. Ich starte mit der Polizeipräsenz vor den Türen des Flughafenhauptgebäudes am Platz der Luftbrücke. Ich erwähne die Sicherheitsprüfungen am Eingang, die den Checks in deutschen Gerichtsgebäuden und auf internationalen Flughäfen ähneln: das Prüfen von Taschen und Kleidung und die Frage, ob man Getränke, Feuerzeug oder Aufkleber dabei hätte – das alles eingebettet in eine Lichtinstallation, die mit ihren auf den Boden projizierten Schlüsselbegriffen erste Per- und Rezeptionskriterien setzt: „Community, Compassion, Recovery, Freedom, Strength, Support, Faith“. Und ich setze fort mit dem Entree, in dem ein raumhohes Textplakat weiß auf schwarz darüber informiert, das hier eine Public-Private-Partnerschaft stattfindet: zwischen der Berliner Landes- und Bundespolitik, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin und der Kultursenatorin, zusammen mit dem Staatsminister für Kultur und Medien, der Bundesministerin für Bildung etc., unter anderem der Botschaft des Staates Israel, dem Zentralrat der Juden in Deutschland, der Bayer AG, der GEMA, der Axel Springer Freedom Foundation und anderen, in Zusammenarbeit mit vielen namentlich genannten Familien, Privatpersonen und Stiftungen. Als Vorspann erzählt die Informationstafel im Eingangsbereich, dass „The Nova Exhibition“ den getöteten Liebsten am 7. Oktober gewidmet sei und die Nova Community (und dazu zählen laut Infotafel unter anderem das Nova Exhibition Board, die Tribe of Nova Foundation und die Nova Exhibition Berlin) allen Beteiligten an dieser Ausstellung dankt. Die Tribe of Nova Foundation wurde unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 als Reaktion auf den Unterstützungsbedarf der 3.500 Überlebenden des Massakers und ihrer Angehörigen gegründet und kümmert sich nach Eigenaussagen nun um deren „Begleitung, um Resilienzaufbau und Unterstützung bei der Vernetzung mit anderen Betroffenen“. Mit Logo und Slogan der Foundation wird die Handschrift des Narrativs gesetzt: „Der Rhythmus is unsere Wurzel. Die Bewegung unser Gebet. Die Erinnerung pulsiert durch unseren Körper. Verpflichtung lebt in unseren Händen und Licht geht auf mit jedem Schritt […].“ Die Nova Exhibition, die seit 2023, von den Gründern des Nova Music Festivals produziert, als Wanderausstellung unterwegs ist und bisher in New York City, Los Angeles, Buenos Aires, Miami, Toronto und Washington D.C. gezeigt wurde, ist nun in Berlin zu sehen, bevor sie voraussichtlich nach London weiterziehen wird. „Oct 7, 06:29 a.m. – The moment music stood still“ thematisiert den Terrorangriff der Hamas und ihrer Unterstützer und das Massaker während des Open Air-Trance-Musikfestivals am 7. Oktober 2023 im Gebiet Eschkol, zwischen Re’im und Be’eri, im Grenzgebiet Israels zum Gazastreifen (Gaza Envelope), bei dem 411 Menschen getötet und 43 Festivalbesucher*innen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Um den Plot vorweg zu nehmen: Die Ausstellung startet in einem für die Besucher*innen verpflichtenden Videovorführraum mit dem Prolog eines fünf-minütigen Films, in dem Festivalbesucher*innen Auskunft zur programmatischen Schönheit, Kollektivität und Solidarität des Nova-Festivals geben und in ihren Erzählungen auf den unfassbaren Moment des Wendepunktes am 7. Oktober, um 6:29 Uhr, „als die Musik still stand“, zusteuern. Die Ausstellung endet mit Zuversicht: „We Will Dance Again“. Wir werden wieder tanzen. Doch bevor die chronologisch linear erzählte Ausstellung zu einem Gedenk- und später zu einem Ort der Zusammenkunft mit infrastruktureller Sorgearbeit wird, werden die Besucher*innen mit den Ereignissen am Morgen des 7. Oktobers 2023 konfrontiert, als der „Rote Alarm“ startete. Gut ein Drittel der abgedunkelten Halle ist mit einzelnen, in Orange ausgeleuchteten Inseln des Grauens konzipiert. Unterhalb von Eukalyptusbäumen aus Plastik sind, so wird informiert, eine Auswahl der rund 20.000 Originalutensilien versammelt, die auf dem Festivalgelände aufgefunden wurden: umgeworfene Klappstühle und Campingliegen, einzelne Badelatschen, zurückgelassene Bücher, Sonnenmilch, aufgerissene Zelte, überrannte Kuscheltiere, zerfetzte Kleidung und Schlafsäcke, Volleybälle, Chipstüten, Abfälle … In diese einzelnen dezentralen Inseln sind Screens unterschiedlicher Größe, zusammen mit je eigenen Lautsprechern, platziert, deren Videos in Endlosschleife in anonymer Urheberschaft und unbenannter Autorperspektive Auskunft geben über die Raketenangriffe, die Durchbrüche der Sperranlagen mit Baggern, die Angriffe der Terroristen auf Motorrädern, die rennenden Menschen über die Felder Richtung Osten, die brennenden Autos entlang der Nationalstraße, aber auch konkret über das Festivalgelände, das hier nachempfunden wird. Diese Bewegtbilder stellen automatisch eine Relation zu der hier ausgestellten und kuratierten Situativität her und informieren über den Vergleich, dass hier näherungsweise eine Originalität in situ kuratiert und inszeniert ist, die zusätzlich durch die eingesetzten Medialitäten virtualisiert und hyperrealisiert wird. Skelette ausgebrannter Autos in der Ausstellung sind weitere (originale?) Zeugen des Grauens, das die etwa 3.500 internationalen Partygäste aus 17 Ländern an diesem Morgen erlebt haben. Nachbauten (?) von Bunkern, von Kugeln durchlöcherten mobilen Toilettenanlagen und einer Getränkebar zeigen, wo und wie die Fliehenden versuchten, sich zu verstecken und doch keinen Schutz fanden. Audioaufnahmen bezeugen die letzten Telefonate, die Ermordete mit ihren Familien geführt haben. Das Ergebnis des knapp neun-stündigen Massakers ist erschütternd: 411 Menschen, darunter Zivilisten und Sicherheitskräfte, wurden getötet und 43 Besucher*innen des Trance-Festivals als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt; 3.710 Überlebende wurden seither als zivile Opfer von Terroranschlägen anerkannt, davon sind 76% junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, 14 der verschleppten Geiseln wurden freigelassen, 15 ermordet. Die ersten israelischen Soldaten trafen zur Mittagszeit ein, das Festivalgelände wurde gegen 15 Uhr final durch das israelische Militär gesichert, so heißt es in dem Wikipedia-Eintrag zum Thema. In diesem polyphonen Stimmen- und Bildergewirr bahnen sich die Besucher*innen ihren je individuellen Weg, sie bücken sich, um unter den Eukalyptusbüschen in die geöffneten Zelte zu schauen oder Handys in die Hand zu nehmen (hierzu wird offensiv durch ein Textplakat am Eingang aufgefordert), auf denen nächste Zeitzeugenvideos zu sehen sind. Informationstafeln geben punktuell Auskunft zum Beispiel zu den Bunkeranlagen entlang der Nationalstraße, zu geschlechtsspezifisch und sexuell eingesetzter Gewalt oder zu einzelnen Personen, die Opfer des Massakers wurden, wie zum Beispiel die Barkeeperin Liron Barba, die Verletzten half, bevor sie selbst getötet wurde. So entsteht im vorderen Teil der Halle eine immersiv-theatral-interaktive Ausstellung, die forensisches Material mit multimedialen Installationen, persönlichen Augenzeugenberichten, künstlicher Vegetation und Memorabilia kombiniert und in orangene Scheinwerferspots taucht. In der Mitte der Halle treffen die Besucher*innen unter einem farbigem Festivalzelt auf die Originalbühne und die Originallautsprecheranlagen (von Function One) des Festivals, vor denen nun nicht mehr die Festivalbesucher tanzen, sondern statt ihrer stellvertretend ein kreisrunder, strahlend angeleuchteter „Alter Code des Lebens“ von Roee Aminof installiert ist. Eine Texttafel informiert, das hier drei Heiltraditionen – der jüdischen Kabbala, der mexikanischen Curanderos und der internationalen Kunst – genutzt würden, „um Wunder und Heilung hervorzurufen“. Aus den Boxen dringen Trance-Klänge, auf herabhängenden wehenden Stofffahnen werden Animationen fliegender Vögel projiziert, dahinter sind Bewegtbilder im Sonnenaufgang tanzender Menschen zu sehen – und damit wird eine In-situ-Situation zu kreieren versucht, für die Originalgegenstände transloziert wurden, sowie Abwesenheiten kultisch und medial kompensiert werden. Wie durch ein Nadelöhr der Trance-Kultur und deren psychedelischen, kultischen und mystischen Effekten gelangen die Besucher in den hinteren Teil der Halle, der im Unterschied zu dem nachgestellten Chaos des Terrors eine klare, strikte, strenge Ordnung praktiziert: Neben der Ansprache an die Besucher*innen, ihre Gedanken und Gefühle auf weißen Kärtchen zu notieren und im Raum zu verteilen, informiert eine 40 Meter lange Gedenktafel, in vier Reihen übereinander, über jeden einzelnen der 411 ermordeten Festivalbesucher*innen mit einem Porträtfoto und einem kurzen Text. Zu diesem Raum der Erinnerung gehört eine ebenso lange Tafel, auf der Kerzen und die handschriftlichen Erinnerungen der Besucher*innen platziert sind. Auf daneben singulär positionierten Tischen sind die auf dem Festivalgelände gefundenen Originalgegenstände nach ikonischem Vorbild der musealisierten Holocaust-Erinnerung geordnet: ein Tisch mit Taschen, einer mit Oberbekleidung, einer mit Technikutensilien wie Uhren, Fotoapparate, Handys und Brillen, einer mit Schuhen, einer mit Kopfbedeckungen, einer mit Tüchern, einer mit Trinkflaschen. Eine interaktive Karte sortiert die gesammelten Daten, Zahlen und Zeugenaussagen und rekonstruiert sie als Ereignisse des 7. Oktobers, zusammen mit den anderen Massakern des Tages entlang der Route 232, in den Schutzräumen und auf den angrenzenden Feldern. Ein Board fordert „Bring Them Home“, bevor die Abbildung eines Lebensbaumes verspricht: „We Will Dance Again“. Wir werden wieder tanzen. Aus dem Raum des Horrors und dem Raum der mystisch-kultischen Heilung wurde ein Raum des Requiems, der mit seinen Tropen unter anderem die Erinnerungskultur der Gedenkstätten des Holocaust aufruft – bevor in den finalen, vier kleineren Räumen ausserhalb der großen Halle der Epilog stattfindet. Dieser Epilog denkt das Geschehen in Form von Infrastrukturen und Institutionen: Zunächst informieren Texttafeln über die Aktivitäten der Tribe of Nova Foundation, über ihre Überlebens- und Heilungskonzepte. In einem anschließenden Ruheraum mit Kissen, Teppichen und Stühlen in braun-beige finden terminierte Gespräche mit Überlebenden im Wechsel mit musikalischen Einlagen statt. Es folgt ein Raum, in dem in einem Film die selben Protagonisten aus dem Film zu Beginn der Ausstellung über ihre Zukunft und über die Zukunft der Festivalkultur sprechen. Abschließend können die Ausstellungsbesucher*innen spenden oder kaufen: T-Shirts, Ketten, Kappen, Kunst. So entsteht statt einer Ausstellung eine Kapelle, die den 7. Oktober als Unschuld, Trauma, Schmerzen, Heilung und Gedenken erzählt und synästhetisch vereint. In dieser Kapelle werden liturgische Zeremonien und Riten im Parcour bereit gehalten, mit deren Hilfe ein Umgang mit dem Ausgangsereignis gefunden werden kann. In diesen Parcour sind die Besucher*innen der Nova Exhibition einbezogen, sie durchlaufen die Etappen der Ereignisse und Gefühlslagen, ausgehend von einer Welt vor dem 7. Oktober, 6:29 Uhr, die in eine Welt danach kippt. Die historische Zäsur wird im Zeitraffer erzählt, die Geschichte des Nova-Festivals steht pars pro toto für die des 7. Oktobers als eine Schmerz- und Heil(ung)sgeschichte, die die Welt grundlegend verändert (hat). Wenn in der Ausstellung geschrieben steht, dass das Massaker das „Leben Zehntausender für immer verändert hat“, dürften in diesem Rahmen diejenigen gemeint sein, für die sich die Tribe of Nova Foundation verantwortlich fühlen und für die bisher 130 Gedenkveranstaltungen und 71 Workshops organisiert wurden. Dabei sind es weitaus mehr Menschen, deren Leben sich für immer verändert hat – denn wessen Leben hat sich direkt oder indirekt nicht verändert, sei es im Gazastreifen, in Israel, Westjordanland, Libanon, Syrien, Iran, Ägypten, durch die israelische, die US-amerikanische oder die deutsche Politik … NOVA EXHIBITION BERLIN, 7. Oktober bis 16. November 2025, Platz der Luftbrücke 5, Di.–Do. 11–20 Uhr, Freitag 11–18 Uhr, Samstag und Sonntag 11–20 Uhr Weitere Veröffentlichungen zum Thema: Lea Wolters: Zwischen Trauma und Hoffnung, in: taz, 06.10.2025, https://taz.de/Ausstellung-ueber-das-Nova-Musik-Festival/!6115240 Ben Ratskoff: Prosthetic Trauma at the Nova Exhibition: Holocaust Memory, Reenactment, and the Affective Reproduction of Genocidal Nightmares, in: Journal of Genocide Research, 02.10.2025, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2025.2551946 Naomi Klein: How Israel has made trauma a weapon of war, in: The Guardian, 05.09.2024, https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2024/oct/05/israel-gaza-october-7-memorials Tom Holert: Die Nova Ausstellung – immersives Entertainment und trügerische Eindeutigkeit, in: krisol, 11.09.2025, https://debatte.krisol-wissenschaft.org/die-nova-ausstellung-immersives-entertainment-und-truegerische-eindeutigkeit/ Julian Daum: Nova-Ausstellung: Noch mehr politische Einflussnahme durch Senat, in: nd, 17.11.2025, https://www.nd-aktuell.de/artikel/1195528.berlin-nova-ausstellung-bildungssenat-koennte-neutralitaet-verletzt-haben.html Ein allegorisches Schiff bricht in einer der dunkelsten Stunden Europas, vor annähernd einhundert Jahren, auf und „segelt“ der sogenannten schönen neuen Welt entgegen, die aber schon damals auf Sklaverei, Kolonialisierung und ethnischen Säuberungen gebaut war. Von ihr wird annähernd einhundert Jahre später mit Hetzjagden auf Migranten und ihren rechtswidrigen Inhaftierungen in Gefängnissen in Florida, Guantánamo Bay und El Salvador nichts übrig geblieben sein. „WARUM IST DIESES JAHRHUNDERT SCHLIMMER ALS DIE ANDEREN?“* Ist diese Reise umkehrbar? Ist sie umkehrbar angesichts des Rechtsdrifts, der Waldbrände und des verfassungswidrigen Abbaus von Grundrechten in Europa? Wohin segelte die „Capitaine Paul-Lemerle“ heute? Wo wäre heute der Fluchtpunkt, die Fluchtroute intellektueller, künstlerischer und politischer Passagiere, die das Schiff auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung durch Vichy, Nazideutschland, Francos Spanien und dem faschistischen Italien ab 1940 evakuierte? Kein Sehnsuchtsort in Sicht? Zumindest kein realer, aber William Kentridge und sein Team öffnen in der Oper „The Great Yes, The Great No“ einen poetisch politischen Horizont, der im Künstlerischen im Allgemeinen, im Surrealistischen im Besonderen liegt … „ES SINGT NICHT NUR DER MUND.“* In „Tristes Tropiques“ berichtete der französische Ethnologe Claude Lévy-Strauss 1955 , wie er im März 1941 auf der „Capitaine Paul-Lemerle“ vor dem Vichy-Regime flüchte. Das Schiff brachte ihn und weitere 200 Fliehende von Marseille auf die karibische Insel Martinique – heute französisches Überseegebiet, das als Region Frankreichs zur Europäischen Union, nicht aber zum Schengen-Raum gehört –, von hier aus weiter in das ersehnte New York. Mit an Bord waren historisch gesichert unter anderen die deutsche Schriftstellerin Anna Seghers, der französische Dichter und Surrealismustheoretiker André Breton und seine Frau und französische Malerin Jacqueline Lamba, der russische Poet Victor Serge, die deutsch-niederländische Fotografin Germaine Krull, der kubanische Maler Wifredo Lam, der deutsche Satiriker Walter Mehring und der deutsche expressionistische Maler Carl Heidenreich. Ihnen allen sollte die Emigration gelingen. „EIN VON SCHREIEN VERKRAMPFTES EUROPA“* Kentridge reichert diese Gemeinschaft um weitere Personen aus anderen Zeitepochen an und lässt sie an Bord der „Capitaine Paul-Lemerle“ gemeinsam zweifeln, streiten, debattieren, tanzen und singen: Mit dabei sind die Tänzerin, Sängerin und Bürgerrechtlerin Josephine Baker (1906-1975), Napoleons Ehefrau Joséphine Bonaparte (1763-1814), als Mitbegründer der antikolonialistischen Négritude-Bewegung Aimé Césaire (1913-2008) und die Feministin Suzanne Césaire (1915-1966) – beide aus Martinique stammend, der französische Schrifsteller Léon-Gontran Damas (1912-1978), der Vordenker der Entkolonialisierung Frantz Fanon (1925-1961), die Schwestern Paulette und Jane Nardal, ebenfalls aus Martinique und Mitbegründerinnen der Négritude. Später tanzen auch Lenin, Trotzki und Stalin zu den Klängen des Kampfliedes der sozialistischen Arbeiterbewegung „Völker hört die Signale“. „ICH GLAUBE MEHR DARAN ZU KÄMPFEN, ALS ZU WEINEN.“ Damit macht Kentridge deutlich: Das Verlorene können wir nicht wiederherstellen. Es ist nicht repräsentierbar. Wir können höchstens ein Porträt des Verlusts zeichnen, dessen, was passiert ist, und damit die Erfahrung des Verlusts gewinnen, um eine Verbindung zum Vergangenen und Verlorenen herzustellen. Daher mischen sich in Kentridges Oper Klänge eines Oratoriums, eines Requiems, einer Kammermusik, einer politisch proletarischen Kampfmusik, eines Songspiels und eines Arbeiterchors. Das Libretto von „The Great Yes, The Great No“ enthält Auszüge aus den Schriften von André Breton, Aimé Césaire, Suzanne Césaire, Léon-Gontran Damas, Frantz Fanon und auch von Bertolt Brecht, dem die Flucht 1941 aus dem skandinavischen Exil über Moskau und Wladiwostok nach Santa Monica gelang. „ICH WILL ES WISSEN, ICH WILL ES NICHT WISSEN, ICH WILL ES WISSEN, SAG MIR NICHTS.“* Doch nicht nur das Personal der Oper und das Textmaterial des Librettos stammt vornehmlich aus dem surrealistischen Zirkel, der sich selbst als eine revolutionäre und internationalistische Bewegung verstand und deren Verbindung zum Antifaschismus jüngst die Ausstellung „Aber hier leben? Nein danke“ im Münchner Lenbachhaus herausarbeitete. Schon mit Gründungsbeginn in den 1920er Jahren kritisierten die Surrealist*innen die europäische Kolonialpolitik, organisierten sich gegen den Faschismus, kämpften im Spanischen Bürgerkrieg, wurden interniert, verfolgt, fielen im Krieg und flohen aus Europa. Parallel zu dem größtenteils entpolitisierten Kunstgeschichtskanon zum Surrealismus, der sich auf das harmlos Traumhafte, Absurde, Unwirkliche und Phantastische kapriziert und dafür das Anarchistische und Revolutionäre opfert, fokussiert sich Kentridge sowohl auf die bedrohten Lebenswelten und Schriften der Künstler*innen, als auch auf die von ihnen angewendete ästhetische Methode: „Die Welt zerschneiden und neu entstehen lassen“, zitiert das Libretto Breton, der sich unter anderem in dem Manifesto for an Independent Revolutionary Art (1938/39) festlegte: „true art is unable not to be revolutionary, not to aspire to a complete and radical reconstruction of society.“ „DIE WELT IST UNDICHT. DIE TOTEN MELDEN SICH ZUM DIENST. DIE FRAUEN SAMMELN DIE SCHERBEN AUF. “* Kentridge lässt auf der Bühne ein Spektakel an dynamischen Cut-ups auf verschiedenen Ebenen stattfinden und fügt sein Opus aus vielen Vielheiten zusammen, ohne sie passend zu montieren: Die Textpassagen sind in den Sprachen der Darsteller*innen auf Englisch, Französisch, isiSwati, isiZulu, isiXhosa, Setswana, Xitsonga und Sepedi verfasst. Multimedial entsteht aus Kentridges unnachahmlichen Zeichnungen und ihren Animationen, aus Fotografien, Found footages und Filmen, aus Gesang, Tanz und Literatur, aus mimischer Darstellung, Musik und Gesang ein Universum, das sich aus Schichtungen und Überblendungen von Live-Handlungen auf der Bühne und Projektionen auf die Bühnenwand zusammensetzt. Während auf der Bühne der „Chor der Sieben Frauen“ das Geschehen mit Gesang, Rhythmus und Sprechgesang klanglich begleitet, wechseln die Darsteller*innen und Tänzer*innen ihre Rollen, indem sie ihre Gesichter mit übergroßen, schwarz-weißen Pappmasken der historischen Personen überdecken und damit entweder die Geflüchteten und Gefeierten von Surrealismus und Négritude verkörpern oder aber ihre Köpfe gegen perspektivisch zu große, surrealistisch anmutende Fisch- und Vogelköpfe, Espressokocher, Telefone und Schreibmaschinen austauschen. Diese collagierten Zusammenfügungen korrelieren mit den filmischen Projektionen auf der Bühnenwand, wenn Tortenstücke und Zylinder tanzen und in den Sternenhimmel rutschen, Land- und Schifffahrtskarten zerreissen und sich neu zusammensetzen, Man-Rays Lee-Miller-Auge auf Figuren aus dem Triadischen Ballett von Oskar Schlemmer auftauchen, zerstückelte Gliedmaßen sich auf einem Kuchenteller gegen ihre Zurichtung durch Messer und Gabel wehren, vitalisierte Schlingpflanzen sich über die Hinterbühne rekeln … Damit füllt sich die Bühne zu einem Kosmos von Absurditäten und Überdehnungen, übervoll mit Assoziationen und Sehnsüchten – ein Fest für Ikonograf*innen, die die verrätselten symbolischen Motive dechiffrieren können, die Kentridge seit über vier Jahrzehnten mit hohem Wiedererkennungswert in seine Werke einbaut. „WIR KÖNNEN DOMINIERT WERDEN, ABER NICHT DOMESTIZIERT.“* Während Fanon in seinem 1952 erschienenen Band „Schwarze Haut, weiße Masken“ das kolonisierte Subjekt psychoanalytisch untersucht und einen psychopathologischen Bruch zwischen der Eigen- und Fremdwahrnehmung diagnostiziert – denn Schwarze Menschen müssten eine weiße Maske tragen, sich die kolonialisierende Kultur aneignen und nachahmen, um durch die Blicke in einer kolonialisierten Welt sichtbar werden zu können –, stattet Kentridge 2025 seine vornehmlich Schwarzen und wenigen weißen Darsteller*innen und Tänzer*innen beliebig mit den schwarz-weißen Porträtmasken des Personals aus Surrealismus und Négritude aus und könnte damit zu einer Neuperspektivierung auch des Themas Blackfacing beitragen: Mit Bretons Methode „Die Welt zerschneiden und neu entstehen lassen“ bilden sich auf der Bühne Körpercollagen aus Menschen und Tieren, Schwarzen und Weißen, Frauen und Männern, heutigen und früheren Zeitgenoss*innen … Damit wird die surrealistische Collagemethode zu einem politischen und epistemologischen Emanzipationstool, das umso stärker zu vibrieren beginnt, wenn es in Europa, in Deutschland, in Berlin auf ein Publikum trifft, das zu den Ereignissen auf der Bühne, zu Kolonialisierung, Flucht und Migration, zu Rechtsradikalität und Faschisierung damals wie heute in einem Verhältnis steht und sich zu verhalten hat. Schade deshalb, dass der Zuschauerraum abgedunkelt oder nicht zumindest leicht beleuchtet war – so oder durch eine Auflösung der distanzierenden vierten Wand hätten Selbstwahrnehmungen und Blicke sichtbar stattfinden können. Der Beifall war euphorisch. * Quelle: Libretto von „The Great Yes, The Great No“ Chor: Anathi Conjwa, Asanda Hanabe, Zandile Hlatshwayo, Khokho Madlala, Nokuthula Magubane, Mapule Moloi, Nomathamsanqa Ngoma Darsteller*innen: Xolisile Bongwana, Hamilton Dhlamini, William Harding, Tony Miyambo, Nancy Nkusi, Neil McCarthy Tänzer*innen: Thulani Chauke, Teresa Phuti Mojela Musiker*innen: Marika Hughes (Violoncello), Liam Robinson (Akkordeon, Banjo), Tlale Makhene (Perkussion), Dana Lyn (Klavier) William Kentridge – Konzept, Regie Eine Produktion von THE OFFICE performing arts + film Zur Zukunft des Tanztheaters Pina Bausch Schon 1978 hatte Pina Bausch die Idee, ihre Produktion „Kontakthof“ 30 Jahre später noch einmal mit der Originalbesetzung aufzuführen. In diesen 30 Jahren wurde „Kontakthof“ zu einem ihrer Schlüsselwerke, ausdifferenziert in drei Versionen: für die Tänzer*innen ihres Tanztheaters, für Schüler*innen und für Rentner*innen Wuppertals. 46 Jahre später sollte nun die Idee auf Anregung ihres Sohnes Salomon realisiert werden, jedoch nicht als Re-Produktion, wie ursprünglich angedacht, sondern als eine cineastische Montage. Meryl Tankard, damalige Tänzerin des „Kontakthof“s, mittlerweile diplomierte Filmregisseurin, nahm sich der 24 Archivbänder der Videodokumentationen an, die seinerzeit Bauschs enger Mitstreiter und Lebensgefährte Rolf Borzik aufgenommen hatte, kürzte die drei Stunden des Originalstücks auf eineinhalb Stunden und behandelte „das Werk wie ein Drehbuch“. (Quelle: Programmheft). Diese auf eineinhalb Stunden gekürzte und neu geschnittene Version von „Kontakthof“ wurde nun als „Kontakthof – Echos of ’78“ im Rahmen des Berliner Theatertreffens aufgeführt. Von den damaligen 20 Tänzer*innen standen neun auf der Bühne und begegneten ihren 46 Jahre jüngeren Videobildern. Pina Bausch, Meryl Tankard, Kontakthof – Echos of ’78, Foto: Oliver Look. Die neugeschnittenen Schwarz-Weiss-Archivbilder wurden auf eine Gaze projiziert, die zwischen Bühne und Publikum und damit als die vierte Wand des Theaterhauses gespannt war. Dahinter öffnete sich das Originalbühnenbild, ein in Grautönen gehaltener, fensterloser Ballsaal mit einer großräumigen, grauen Tanzfläche, mittig eine Kinoleinwand, zunächst von einem schwarzen Vorhang verdeckt, flankiert von Stühlen, Mikrofonen und einem Klavier in der hintersten Ecke. Borzik hatte dieses Bühnenbild 1978 als Zitat der Lichtburg entworfen, ein ehemaliges Kino in Wuppertal-Barmen, in dem Bausch und ihre Company damals probten. Eine Lichtquelle links tauchte den Tanzsaal/die Bühne in entsprechende Farben – anfänglich in das kontrastreiche, gedämpfte Schwarz-Weiss oder Grau der Filmaufnahmen, später in warme Lichttöne, als sich die Farben und mit ihnen die Live-Ereignisse auf der Bühne immer stärker durchsetzen sollten. Doch bis es dazu kommen sollte, bestimmten die Archivbilder das Geschehen auf der Bühne. Denn meist fielen die Projektionen der Tänzer*innen, die diese ja ohnehin überblendeten, weitaus größer aus als die Personen in realita; die Tänzer*innen orientierten sich für ihre Bewegungen an den Kamerabildern und Kameraperspektiven Borziks, sie wurden damit zu (asynchronen) Echos ihrer 46 Jahre jüngeren Videobilder; auch die O-Töne der Archivbilder waren maßgeblich und wurden hin und wieder um weitere Live-Töne angereichert, die sich dann zeitversetzt, daneben, darüber, dazu mischten. Der Film wurde damit zu der bestimmenden Matrix, das Theaterhaus zu einem Filmhaus im Theater, in dem das intermediäre Geschehen stattfand: Live-Bewegungen und Video, Live-Klänge und O-Töne des Archivmaterials stellten ein ästhetisch multisensorisches Medien-Crossover dar, sie blieben in ihren Differenzen und spezifischen Merkmalen bestehen, hin und wieder fusionierten sie konzeptionell, wenn sich wechselseitige Interaktionen zwischen dem Material oder Variationen in den Wiederholungen andeuteten. Doch die Kontextbestimmung, die bei Intermediärem durch den Text erfolgt, blieb in diesem Teil der Aufführung uneindeutig. Pina Bausch, Meryl Tankard, Kontakthof – Echos of ’78, Foto: Ursula Kaufmann. Im typischen Pina-Bausch-Repertoire der Bewegungen kombinierten die Tänzer*innen Pantomime, Alltagsgesten, manchmal auch Sprache, Klänge und Gesang, sie durchschritten den Bühnenraum, sie koordinierten sich in der Gruppe oder in Gruppen, sie tanzten ein Spektrum an raumgreifenden Gesellschaftstänzen als Solo-, Paar- und Gruppentanz (Walzer, Jive, Tango, Swing, Disco) – selbst dann, wenn der frühere Partner, die frühere Partnerin fehlte. Dieses Fehlen wurde durch offensichtliche Lücken sicht- und fühlbar gemacht: manchmal fehlte das Gegenüber im Paartanz, manchmal blieb ein Stuhl leer, manchmal fing niemand beim Hinuntergleiten auf den Boden auf. So formte sich eine berührende Wehmut, die das Publikum mit einer überwältigenden Offenherzigkeit gegenüber dem Ensemble, das hier vermutlich ein letztes Mal zusammen performen dürfte, auszugleichen versuchte. Denn selbst die Verdoppelungen der Figuren, manchmal sogar Verdrei- und Vervierfachungen durch weitere Projektionen und Schattenbildungen an der rechten Bühnenwand vermochten nicht, die Lücken auszugleichen – zumindest nicht in der ersten Hälfte des Stücks … Diese endete mit einer Zäsur, die ab dem Moment auch den Kontext eindeutig bestimmen sollte: Die neun Tänzer*innen platzierten sich an der Bühnenrampe, mit direktem Blick in das nun nicht mehr abgedunkelte Publikum, in einer Reihe und mit Lücken zwischen sich. Eine nach der dem anderen stellten sich persönlich vor, nannten ihren Namen, ihr Alter (zwischen 69 und 81), ihre aktuellen Hauptbeschäftigungen und ihre vordringlichen Befindlichkeiten: Elisabeth Clarke, Arthur Rosenfeld, Josephine Ann Endicott, Meryl Tankard, John Giffin, Beatrice Libonati, Ed Kortlandt, Anne Martin, Lutz Förster. Pina Bausch, Meryl Tankard, Kontakthof – Echos of ’78, Foto: Ursula Kaufmann. Nach der Pause war Schluss mit den farbschluckenden, auf Abstand bringenden, verschattenden Überblendungen. Das Reenactment, das sich bis dahin am Film als bestimmender Matrix orientierte, indem die Tänzer*innen für ihre Bewegungen sogar die Kameraperspektiven übernahmen, emanzipierte sich. Das Theater eroberte sich seinen Raum zurück und bot sich als eindeutiger Kontext an, in dem eine Medienemergenz stattfinden konnte. Die Archivbilder wurden nun auf der Kinoleinwand hinter den Tänzer*innen, deren Vorhang zwischenzeitlich geöffnet wurde, gezeigt. Teilweise wurden sie durch eine zweite, gleiche Projektion neben der Leinwand, direkt auf der Wand des Tanzsaals gedoppelt. Hierfür wurde ein Filmprojektor ins Bild geschoben, der in seiner überdimensionierten Behäbigkeit auf Rollen wie ein weiterer Zeitzeuge, nun des Technisch-Apparativen wirkte. Die Kostüme wurden farbig, das Licht strahlte, nun überblendete nicht „1978“ „2025“, nun orientierte sich nicht „2025“ an den Bildern von „1978“, sondern „2025“ setzte im Kontext Theater Motive, die manchmal nur an den Rändern der Videoaufnahmen oder sogar außerhalb ihres Rahmens zu erahnen waren, fort, nahm hierauf neu interpretierend Bezug oder interagierte mit dem Archivmaterial. Darüber wurden die bisherigen Lücken zu Spuren, Spuren, die durch einen komparatistischen Blick 1978 mit 2025 zu vergleichen in der Lage waren und bemerken ließen, dass zum Beispiel geschlechterhierarchisch angelegte anzügliche Blicke und Bewegungen im Alter abschwächen und nachlassen (können), dass geschlechterunterwerfende Requisiten, Kostüme. Gesten und Schlager („süßes Fräulein“) inhaltslos und banal und damit auch ungefährlich werden (können), dass Meryl Tankard, 1978 von einer Gruppe männlicher Tänzer in schwarzen Herrenanzügen belästigt, 2025 dieser bedrängenden Filmszene gegenüber stehen, sich mit diesen Bildern konfrontieren und schlussendlich die Rezeption dieser frühen Bilder verweigern konnte, indem sie die Bühne verließ. Die anfänglichen Zweifel, ob das stark ausgedünnte Stück, medial durch den Film überblendet, dramaturgisch gehalten werden könne, wurden durch sich allmählich herausbildende Bedeutungsebenen aufgefangen: Es bildeten sich verschränkte Zeitschichten, Alterungsprozesse wurden sichtbar, unterschiedlichste „Kontakte“ hergestellt, Körperpolitiken thematisiert, Lücken fühlbar und Schmerz aushaltbar. Durch Interaktion, Reaktion und Resonanz entstand währenddessen ein theaterhistorisch und tanzgeschichtlich magisches Gewebe, das eine Ahnung gab, wie die Zukunft von Pina Bauschs Tanztheater aussehen könnte: genau dann, wenn das Reenactment zu einem Preenactment wird. Pina Bausch, Meryl Tankard, Kontakthof – Echos of ’78, Foto: Uwe Stratmann. Kontakthof – Echoes of ’78 ist eine Produktion von Sadler’s Wells, Pina Bausch Foundation und Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Sie wird koproduziert mit Amare-The Hague, LAC Lugano Arte e Cultura, Festspielhaus St. Pölten, Seongnam Arts Center und China Shanghai International Arts Festival und wird als Beitrag zur Vorbereitung des Pina Bausch Zentrums aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Wuppertal gefördert. Zum Auftakt des Berliner Theatertreffens 2025 Der so einfach wie brutale Plot des Dramas ist schnell erzählt: zehn Frauen – drei Generationen eines Familienverbunds und ihr Personal – drehen sich um einen Mann, der als (beinahe) Einziger überleben wird, ohne dass er zur Handlung auch nur eine einzige Textzeile beigetragen oder erkennbar Zutritt in das Frauenhaus (außer als begehrtes Foto) gehabt hätte. Die Frauen werden in einem kollektiven Feminicidio Täter-und-Opfer-zugleich eines, ja ihres perfiden Macht- und Unterdrückungssystems in einem, ja ihrem verschlossenen Familiensystem. Hier können also nicht die Gründe liegen, dass die Inszenierung von Federico García Lorcas Dreiakter „Bernarda Albas Haus“ durch Katie Mitchell am Hamburger SchauSpielHaus zum 62. Berliner Theatertreffen als eine der zehn besten Theaterinszenierungen der Saison aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen wurde. Bernarda Albas Haus © Deutsches SchauSpielHaus Hamburg, Screenshot aus: https://www.berlinerfestspiele.de/theatertreffen/programm/2025/10-inszenierungen/bernarda-albas-haus Das Herausragende dieser Inszenierung ist die kinematografisch-theatrische Experimentalität der Aufführung des Dramas, das Lorca 1936 zwei Monate vor seinem Tod fertig stellte und mit dem er als Teil einer Trilogie, so die dominierende Lesweise, gegen die Unterdrückung der Frauen im faschistischen Spanien der 1930er Jahre anschrieb. Das Drama spielt sich über 90 Minuten in dem quergeschnittenen zwei-etagigen Wohnhaus ab, das als Breitbild angelegt ist (Bühne Alex Eales): in der unteren Etage mittig ein größerer Gemeinschaftsraum mit einem gemeinsamen Esstisch, rechts flankiert von einer Küche, durch deren Fenster gleißendes Licht einer Außenwelt dringt, links versperrt ein massives Gittertor den Weg in dieses sich dahinter andeutende Außen. Bernarda, titelgebende Schlüsselfigur des Stücks, hat eben diese Schlüsselgewalt über das Frauenhaus, in dem „Peter“ als Projektionsfläche für Begehren, Lust, Eifersucht, Neid, Schmerz, Sehnsüchte … aller Bewohnerinnen dient. In der zweiten Etage des Hauses reihen sich der Breite nach einzelne Schlafzellen der Frauen aneinander, der fünf Töchter und der so ver-rückten, wie wahr-sprechenden Großmutter, die als Kassandra monologisch durch die Stockwerke, Zeitsphären und Bedeutungsebenen irrt. Beide Etagen sind durch eine Treppe miteinander verbunden. Das Geschehen wird als eine Totale inszeniert, das Publikum hat einen freien Blick auf das gesamte einsehbare Geschehen. Bernarda Albas Haus © Deutsches SchauSpielHaus Hamburg, Screenshot aus: https://www.berlinerfestspiele.de/theatertreffen/programm/2025/10-inszenierungen/bernarda-albas-haus Wie in einem Splitt Screen finden nun in den zehn Räumen auf zwei Etagen und dazwischen parallele Einzelhandlungen statt, die zu Mise en Scènes choreografiert sind. Hin und wieder synchronisieren sie sich durch gemeinsame Sprechanteile der ineinander montierten Dialoge. Diese Technik der parallelmontierten, über- oder auch einschneidenden dezentralen Konversationen verlangt entweder maximale Aufmerksamkeit oder aber Selektionstechniken der Wahrnehmung, um im Plot zu bleiben – oder aber die Gewissheit, dass der Plot auch beiläufig begriffen werden kann. Hin und wieder zentralisieren sich die Einzelhandlungen auch zu einer einzigen Handlung im Gemeinschaftsraum, aus der die Beteiligten aber wieder herausdrängen oder herausgedrängt werden und in die um- und anliegenden Räume und Zwischenräume flüchten. Die Totale des Bühnenbildes wird so zu einzelnen Szenenbildern, in dem in Zusammenarbeit mit Lichteffekten (James Farncombe) das filmische Repertoire von Einstellungsgrößen (von Panorama über Halbtotale und Halbnahe bis hin zu Großaufnahmen) eingesetzt wird, ohne dass je ein technischer Einsatz, zum Beispiel einer Videokamera stattfände. Kombiniert wird diese Splitt Screen-Technik mit Tempi-Änderungen in Form von geschwindigkeitsverlangsamenden Zeitlupen von Bewegungsstudien der Schauspieler*innen. Denn Mise en Scène bedeutet im Film nicht nur einen Raum, sondern auch eine Zeit zu organisieren. Diese Tempi-Änderungen schaffen zusammen mit einem starken Sound (Melanie Wilson) einen gestreckten Platz für dramatische Momente, die in dieser Medialität verfasst sprachlos bleiben und ihre rezeptive Wirkung entfalten können. In ihrer Montage ähnelt Mitchells „Bernarda Albas Haus“ daher einem filmischen In-Szene-Setzen im Theaterraum. Bernarda Albas Haus, © Thomas Aurin Denn menschliche Dramen entwickeln sich nicht nacheinander, proportional oder kausal begründbar. Sie passieren, ohne dass ihr Verlauf von einem Fluchtpunkt einer perspektivischen Ab-Bildung als ein Brennpunkt gesteuert, choreografiert, kontrolliert, vorhergesagt oder arrangiert werden könnte. Vielmehr überlagern, dynamisieren und kreuzen sich die Emotionen, Ereignisse, Stimmungen, Vorhaltungen und Projektionen. Und so synästhetisieren sich die Kräfteverhältnisse der Ereignisse in ihren Sicht- und auch Nichtsichtbarkeiten, ohne das inszenatorische Schwerpunkte betont werden müssten. Genauso mergen die Texte (Alice Birch, übersetzt von Ulrike Syha) in- und übereinander zu einem verstörenden Rauschen und potenzieren sich zusammen mit einem anschwellenden Elektroniksound, der mal funktional extradiegetisch als verbindender Soundteppich eingesetzt wird, mal intra- genauer autodiegetisch sich mit dem Plot verbündet und dessen Dichte und damit seine Dringlichkeit erhöht. So entsteht eine multisensorische Polyphonie vieler Bilder und Stimmen, die dem Ton selbst eine Plastizität inmitten des Theaterraums verleiht. Bei „Bernarda Albas Haus“ in der Inszenierung des Hamburger SchauSpielHauses handelt es sich um eine Variante postdramatischen Theaters, bei der allerdings nicht nur, wie hinlänglich erprobt, die Personen multipliziert und hinsichtlich ihrer Autorschaft, Identität oder Authentizität dekonstruiert werden. Hier werden auch die installativen Orte Teil eines szenischen Netzwerks und mit einer Handlungsmacht ausgestattet, so dass auch sie zu Mitakteuren innerhalb des (titelgebenden) Frauenhauses werden. Dieses Theater wird kinematografisch konstruiert, ohne dass wie bisher bekannt, eine Videokamera zum Einsatz käme. „Postdramatisch“ – vielleicht hier sogar spezifischer „dramatischpostdramatisch“– wird damit einmal mehr (statt einer Gattung) zu einem Verfahren, Theater zu machen. Interessant dürfte sein, wie die TV-Produktion von 3sat das Filmische dieser Theaterinszenierung aufgreifen und sich wiederum in deren Medialität niederschlagen wird: Samstag, 3.5.2025, 20:15 Uhr auf 3sat oder für ein Jahr in der Mediathek der Berliner Festspiele zu sehen. Dieses Beobachtungen entstanden im Anschluss an die Aufführungen „Glacial Decoy / In the Fall / Working Title“ der Trisha Brown Dance Company in Zusammenarbeit mit Noé Soulier, die im Rahmen der Performing Arts Season 2024/25 am Berliner Festspielhaus aufgeführt wurden. Die drei Choreografien entstanden in den Jahren 1979, 2023 und 1985. Während „Glacial Decoy“ und „Working Title“ von der US-amerikanischen Tänzerin, Choreografin und documenta-Teilnehmerin Trisha Brown (1936-2017) stammen, choreografierte „In the Fall“ der französische Tänzer und Choreograf Noé Soulier (geboren 1987) auf Einladung der Trisha Brown Dance Company in Auseinandersetzung mit ihrem Werk. 2 Ikonen, 4 Fotografien, 4 Tänzerinnen, 4 Wände „Glacial Decoy“ von 1979 ist Trisha Browns erste Arbeit für die Theaterbühne mit ihrer nur einen offenen Wand zum Publikum. An der hinteren Wand sind die Projektionen von vier raumhohen Schwarz-Weiss-Fotografien mit abgerundeten Ecken von Robert Rauschenberg zu sehen. Die Motive, die in der nüchtern dokumentarischen Bildsprache der Neuen Sachlichkeit ästhetisiert wurden, wandern alle 5 Sekunden von links um eine Position nach rechts, um links ein nächstes Stilleben in die Vierer-Reihung aufzunehmen: ein aufgewickeltes Kabel, ein Möbeldetail, ein Baum, eine offene Tür, ein parkendes Auto, ein Verkehrsschild, eine Häuserwand, Wäsche auf der Leine, eine Uhr. Der kontinuierliche Fortlauf der insgesamt 159 Bilder – zwischen ihnen ein geringer weißer Abstand – wird mit dem Klickgeräusch eines Diaprojektors kombiniert, ansonsten herrscht (wie in den Stilleben) Stille auf der Bühne und das Licht leuchtet die Bühne (ebenfalls wie in den Stillleben) scharf aus. In 25 Minuten finden 4 Tänzerinnen in diaphan weißen, weichen, flüchtig körperumspielenden Kleidern, die an antike Karyatiden erinnern (ebenfalls von Rauschenberg), die unterschiedlichsten Positionen und Proportionen zueinander und im Raum. Wie die Fassadengliederung antiker Gebäude nehmen sie geometrisch die ganze Breite der Bühne ein, verschwinden dabei auch in die Seitengasse, um sich seriell auf der anderen Seite der Bühne wieder aufzufüllen und damit auch ein Nebengeschehen außerhalb der Bühne zu suggerieren. Mal eine, mal zwei, mal drei, mal vier Tänzerinnen – sie hüpfen, springen, kippen, gehen, laufen, rutschen, stürzen, schlittern, galoppieren in je unterschiedlichen Kombinationen, Tempi und Qualitäten. Und manchmal verursachen sie auf dem Bühnenboden Geräusche. Die Serialität der Tänzerinnen suggeriert ihre Unendlichkeit, wenngleich die Tänzerinnen schon allein durch die beweglichen Kleider nicht stereotypisiert wurden, sondern auch über Frisuren, Körperproportionen und Hautfarben individualisiert werden. Ihre Bewegungsstudien reflektieren körperliche Verfasstheiten ebenso wie Zuordnungen und Abläufe: kontradiktorische Bewegungen, gleiche, gleitende, wiederholende, versetzte, symmetrische, spiegelbildliche Bewegungen, parallele, aus dem Takt geratene, unterbrechende, unerwartete, unvorhersagbare, unwahrscheinliche, sich berührende, einander wegstoßende Bewegungen, als Solo, im Duett, im Terzett, im Quartett. Wie die stark kontrastierten Fotografien von Alltagsmotiven im Hintergrund werden hier sowohl alltägliche Bewegungen (ohne in private oder öffentliche, intime oder distanzierte Bewegungen zu differenzieren), als auch Proportionen, Zuordnungen und Geschwindigkeit streng konzeptionell, ja beinahe systematisch in ihrem Optionsspektrum ausgeleuchtet. Die selbst leuchtenden Fotografien im Hintergrund und ihre alle 5 Sekunden stattfindende kontinuierliche Bewegung von links nach rechts laufend deuten intermedial auf den Film hin. Wie ein verzögerter Experimentalfilm (die Bildfrequenz lag in der Anfangszeit der bewegten Bilder bei 16 Bilder pro Sekunde) montiert „Glacial Decoy“ (Gletschertäuschung) nicht nur kinematografisch zweidimensionale Bilder, sondern mit den Ereignissen auf der Bühne drei- und vierdimensionale, kompositorische Figurationen, die, so scheint es, sich während des Stücks dynamisieren und beschleunigen, um zum Ende wieder in einen langsameren Rhythmus zurückzufallen. Die halbrunden Ecken der Schwarz-Weiss-Fotografien bringt noch ein weiteres mediales Element in das Gefüge und aktualisiert „Glacial Decoy“ um die Materialität von Smartphones-Displays. Weiteres bei Interesse: Browns Echo-Studien werden bei Soulier zu EchoHochVier (Brown, Newman, Malewitsch). „In the Fall“ choreografierte Noé Soulier 2023 auf Einladung der Trisha Brown Dance Company in Auseinandersetzung mit Browns Werk. Ebenfalls in 25 Minuten tanzen die vier vorherigen Tänzerinnen, erweitert um 4 weitere Tänzer*innen, nun in Hosenanzügen in den Grundfarben rot, gelb und blau. Das Bewegungsrepertoire Browns wird von Soulier dialogisch aufgenommen und in seinen Bezügen, Regeln und Aufbauten verstärkt. Indem Soulier seine choreografischen Prinzipien wie ein Layer über Trisha Browns Tanzstil legt, faltet er ihre Grammatik auf. Auch hier werden Pas de deux getanzt, Balancen und Drehungen in verschiedenen Posen gezeigt, die Tänzer*innen werden gehalten, gehoben, geführt, sie drehen sich und (in-)einander, sie springen allein, zu zweit … zu acht, sie beschleunigen und verkomplizieren. Auch hier wird der Raum vermessen, diesmal kombiniert mit einer Farbausleuchtung durch die Scheinwerfer und einem kontinuierlichen Grillengeräusch, das später mit Percussion zu einem breiteren Sound angereichert wird. Auch hier finden die verschiedensten Konstellationen und Kombinationen unter den Tänzer*innen, zum und im Raum statt. Wie Figuren aus einem suprematistischen Bild von Kasimir Malewitsch springen sie aus der Bildfläche in den Bühnenraum und wirbeln, schleudern, strecken, kippen und wippen. Stärker aber noch als bei Trisha Brown werden hier die Interaktionen, Resonanzen und Referentialitäten thematisiert sowie die Bewegungen durch Ausdehnungen, Gleichgewichte und Verzögerungen reflektiert und dezentriert. Elemente aus dem Yoga, Tai Chi und Aikido scheinen integriert zu sein. Anstrengungen, Kraft und Konzentration dringen in die Bewegungen ein. Die Tänzer*innenkörper werden in eine Aushandlung mit Trägheit und Schwerkraft gebracht. Souliers „In the Fall“ operiert wie ein zeitgenössisches Echo auf Brown, die Reflexionen von Bewegung und Raum werden daher um eine nächste Reflexionsebene erweitert, nämlich die eines historisch kanonisierten Tanzstils. Aber nicht nur das, reflektiert wird auch eine weitere kunsthistorische Ikone: Das übergroße Ölgemälde „Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue“ von Barnett Newman Ende der 1960er Jahre verhandelt in seinen Versionen I bis IV die Verhältnisse der Farbflächen zueinander. Während Newman die drei Grundfarben und die senkrechte Gliederung durch die Farbfelder in seinen Gemälden beibehält, die Verhältnisse der Farbflächen zueinander verändert, indem er ihre Reihenfolge und Breite variiert, changiert Soulier nicht nur die Farben in ihrer Anzahl und Kombinatorik der Tänzer*innen, sondern lässt auch die senkrechte Gliederung in den Gemälden durch die Farbfelder in die Waagerechten und Schrägen kippen. Während Newman Gleichgewicht auslotet, Browns „Glacial Decoy“ eine Kontrolle über das Gleichgewicht vortäuscht, liegt Souliers Interesse bei „In the Fall“, dem Titel zu urteilen, im Fallen. Die Tänzer*innen dehnen ihre Körperposition sowohl physisch als auch zeitlich bis zu dem prekären Moment, in dem es kein Halten mehr gibt, sie aber nicht fallen, sondern mit einer Bewegung zu einer nächsten Körperposition gelangen. Dieser Moment, in dem die Kontrolle zu verlieren droht, wird von der Choreografie überbrückt. Erzählen und Erinnern als Kombinatorik Hier hätte der Abend enden können, nach einer Pause folgt „Working Title“ von Trisha Brown aus dem Jahr 1985. Die acht Tänzer*innen bewegen sich nun in matt farbenen Patchworkanzügen zu einer experimentellen, improvisiert scheinenden Musik, bestehend aus Blasinstrumenten und Percussion, angereichert um Alltagsklänge wie Pusten, Klopfen und Rauschen, ohne dass sie durch einen Rhythmus vereinheitlicht werden und damit eine Komposition hätte erkenntlich werden können. Nur das heitere und muntere Klangbild wirkt und verbindet sich (scheinbar) mit den Bewegungen der Tänzer*innen in ihren bunten Kostümen und dem bunten, den Raum transformierenden Licht. Das gleiche Bewegungsvokabular wie in „Glacial Decoy“ und die gleiche ausbuchstabierte Bewegungsgrammatik in „In the Fall“ wirken nun, kontextualisiert durch Licht, Farbe, Kostüme und Klänge, freudig, lebenslustig, vergnügt, fröhlich und launig – also in einer Stimmung. Auf einmal scheint etwas erzählt, statt nüchtern analysiert zu werden. Auf einmal scheint die vierte offene Wand zum Publikum durchstoßen zu sein. Und auf einmal dominiert nicht die Erinnerungsleistung der Choreografie durch die Tänzer*innen, denn hier scheinen sie in einer Geschichte aufgehoben zu sein, die sie durch die 25 Minuten des Stücks leiten könnte. All das aber irrtümlich, denn die experimentelle Komposition ist exponentiell eine Herausforderung, denn statt zu verbinden, zerteilt sie die Bewegungen, den Raum und sich scheinbar andeutetende Muster. Athletik und Ausdauer werden von den Tänzer*innen gefordert. „Working Title“ zeigt sich im Einsatz dieser beiden Anforderungen als ein optimistischer work-in-progress, in den 1980er Jahren in den USA wissentlich anders als heute 2025 zu bewerten. Daraus ergaben sich aber weitere Einsichten: (1) Bevor ohne Titel (10.000 Watt) zu einer installativen Lichtsäule wurde, war sie Ioannis Oriwol entdeckte die Einzelbestandteile während seiner ortsspezifischen Recherchen im ausgelagerten Fundus des Theaters Erfurt. Er wählte sie aus, deklarierte sie damit zu Objets trouvés, zu gefundenen Gegenständen, kunsthistorisch als Ready-mades genrefiziert. Er montierte sie zu einer vertikalen Säule, indem er die Spiegelschein-werfer in ihrem kreisrunden, industrie-ästhetischen Gehäuse paarweise anordnete und dafür ihre Leuchtflächen begegnen ließ, indem er Transformatoren einsetzte, damit diese den Strom in eine Niederspannung mit gleichzeitig entstehender höherer Stromstärke umwandeln konnten und indem er die Scheinwerfer und die Transformatoren durch Stromkabel miteinander verband. Aufgehängt in die Vertikale innerhalb eines modularen Gerüsts, unterteilt durch horizontale Streben, sollte diese Säule für drei Stunden am Abend des 5. Dezembers 2024 auf der Probebühne des Theaters Erfurt installiert sein und leuchten. (2) ohne Titel (10.000 Watt) ist eine raumhohe Lichtsäule, montiert aus zehn 1.000 Watt-Spiegelscheinwerfern, deren massive Industriematerialität imponiert. Installiert auf der abgedunkelten Probebühne des Theaters Erfurt an einem Dezemberabend 2024 ist sie ein Geschenk von Ioannis Oriwol an das Theater für seine Freude an den im Fundus archivierten Objekten. Aus den schmalen Zwischenräumen der sich begegnenden Leuchtflächen der Scheinwerfer dringt gleißendes Licht. Wie an einem Tropf hängen die zehn Spiegelscheinwerfer an zehn Transformatoren, die auf dem Boden drapierten Stromkabel wirken wie überdimensionierte Schläuche, durch die die Infusionen transportiert werden. Hier sind die Infusionen elektrischer Strom, durch die Transformatoren in eine höhere Stromstärke umgewandelt. Die Lichtsäule brummt, sie wird durch fünf am Boden installierte LED-Scheinwerfer bernsteinfarben angestrahlt. Schatten des Gerüsts zeichnen sich an der Raumdecke ab. Die 10 mal 1.000 Watt stehen unter Strom, es steht uns ein starkenergetisches Modell mit hohem Stromverbrauch gegenüber. ohne Titel (10.000 Watt) irritiert: Wie ist es möglich, dass zehn aufgetürmte 1.000 Watt-Spiegelscheinwerfer in ihrer Materialität, Massivität und Stromintensität transluziert und poetisch wirken können? Mit Andacht stehen wir vor der Lichtsäule, umrunden sie in respektvollem Abstand, flüstern, bemerken unseren andächtigen Habitus, registrieren Pathos und Erhabenheit bei gleichzeitigerSkepsis. Damit wäre angesichts der technischen Ausgangsbestandteile nicht zu rechnen gewesen. Übersummativität bezeichnet die emergenten Eigenschaften eines Systems, die nicht auf seine Einzelelemente zurückzuführen sind. Die Lichtsäule lockt, sie historisch zu deuten: als eine Technikgeschichte, die wohl während des 1. Weltkriegs mit der Erfindung der Spiegelscheinwerfer-Technologie startete, die während des 2. Weltkriegs als Militärtechnik ihren Einsatz fand und dann im Zivilbereich in verkleinerter Variante zum Beispiel als Theaterbühnentechnik eingesetzt wurde. Sie könnte aber auch als eine deutsch-deutsch-deutsch-deutsche Geschichte erzählt werden, von der Anwendung der Technologie im monarchischen Deutschland, später dann im nationalsozialistischen Deutschland über ihre Produktion in sozialistischen Fabriken in der DDR bis hin zu ihrer Wiederentdeckung 2024 im Fundus des Theaters Erfurt durch Oriwol im Rahmen seiner recherchenorientierten, ortsspezifischen und situativen Post-Studio-Practices. ohne Titel (10.000 Watt) könnte aber auch eine ökologische Geschichte von Energiege- und -verbrauch im 20. Jahrhundert, von fossilen Energieträgern und der Neuentdeckung von Nachhaltigkeit bis zur Dekarbonisierung erzählen. Oder sie könnten zu einer Geschichte des Ready-mades anregen, die kunsthistorisch uneindeutig ist: Startete sie mit Lautréamonts „Schön wie die Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch“ 1874 oder war es Marcel Duchamp, der mit dem Fahrrad-Rad (1913), dem Flaschentrockner (1914) oder mit Fountain (1917) das Konzept des Ready-made begründete? Jüngst verwirrte Siri Hustvedt, als sie in ihrem Roman Damals zu dem „Kunstverbrechen“ ausführte, dass Fountain statt von Duchamp von Elsa von Freytag-Loringhoven geschaffen wurde, sie aber „aus der Geschichte herausgeschrieben [wurde]“. Und noch ein medientheoretisches Deutungsangebot: The Sublime Is Now proklamierte Barnett Newman 1948 mit Blick auf seine monochromen und großformatigen Farbfeldmalereien, später entstand Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue. Kunst- und medienhistorisch ist es inspirierend, ohne Titel (10.000 Watt) als eine Fort-, Über- und Versetzung von Themen wie Erhabenheit und Pathos oder von Gattungen wie raumgreifende Öl- oder Acrylbilder, diesmal aber mit anderen Medien zu lesen – und dazu gehören bei ohne Titel (10.000 Watt) ohne Frage auch die installativen, performativen und theatralen Dimensionen der Lichtsäule. (3) Nach ihrer Präsentation und Ausstellung am Abend des 5. Dezembers 2024 auf der Probebühne des Theaters Erfurt wurde ohne Titel (10.000 Watt) in ihre Einzelteile demontiert. Spiegelscheinwerfer, Transformatoren, Stromkabel und Dimmer waren und sind im Eigentum des Theaters Erfurt, sie kehren in den Fundus des Theaters Erfurt zurück. Die Objets trouvés werden damit erneut zu unmarkierten und unausgewählten Gegenständen, die vielleicht auf ihre nächste Wiederentdeckung warten … Tarane Bazrafshan 5.12.2024, zugänglich zwischen 19 und 21 Uhr, studio.box, Theater Erfurt Franz Kafka war, so wird gerade in seinem 100. Todesjahr informiert, ein leidenschaftlicher Schwimmer. Tarane Bazrafshan lässt Kafkas Erzählung Der Bau (1923–24) von einer Rennradfahrerin in Aktion erzählen. In einem körpernahen schwarzen Zeitfahranzug, mit einem aerodynamischen, weißen Profihelm auf dem Kopf, unter dem festgeflochtenes dunkles Haar zum Vorschein kommt und in schwarzen Radschuhen mit Klickpedalen sitzt die Performerin inmitten der studio.box des Theaters Erfurt auf ihrem Carbon Rennrad, das auf einem Rollentrainer montiert ist. Sie radelt und radelt und radelt, ohne dass wir Rezipient*innen einen Anfang oder ein Ende erleben. Währenddessen liest sie den monologischen Textstrom weiß auf schwarz von einem vor ihr installierten Teleprompter. Links und rechts vor ihr spenden silberglänzende Ventilatoren Luft, in der Nähe überwacht ein Sanitäter das Geschehen. Dass Kafka Sportler gewesen sei, ist hier nicht mehr als eine anekdotische Korrelation. Vielmehr führte Bazrafshan Lektüre von Der Bau sie zu dieser bildlich-performativen Übertragung, die die isolierte und ausweglose Selbstbezüglichkeit des Ich-Erzählers in den Blick nimmt. Ein nicht näher bestimmtes Tier gibt sich in Kafkas Erzählung den Optimierungsmaßnahmen seines unterirdischen Baus hin und nimmt dabei in selbstvergessener Sicherheitsparanoia den Kampf mit einem wohl von ihm selbst produzierten Geräusch auf. Closed Circuit wird die Rückkopplung (sowohl die auditive als auch die visuelle) zwischen In- und Outputsignalen eines Aufnahme- und Wiedergabesystems bezeichnet. Diese Rückkopplung führt zu einer Signalverstärkung und generiert ein geschlossenes Feedbacksystem. In der bildenden Kunst wurde in den 1970er Jahren (u.a. durch Dan Graham, Nam June Paik und Bruce Nauman) installativ und videoskulptural dazu gearbeitet, um sowohl mediale, aber auch – wie im vorliegenden Fall – physisch-psychische Wahrnehmungsparadigmen zu untersuchen. Unermüdlich, bald schon atemlos kämpft die Performerin auf ihrem Rennrad mit den Mitteln der paratheatralischen Experimente aus Jerzy Grotowskis special projects gegen die Verödungsgefahr des geschlossenen Systems an. Denn ein System, das nur sich selbst und nichts darüber hinaus produziert, wird, so warnt die Thermodynamik, von einem entropischen Zustand eingeholt; hier werden alle Unterscheidungen aufgehoben, denn hier existiert kein Input, der Unterschiede zu erzeugen in der Lage wäre. Wie eine Hochleistungsrennradfahrerin ist dabei die Performerin auf sich selbst und nur auf sich selbst zurückgeworfen. Sie radelt und radelt und radelt und liest Kafkas Der Bau, mal atemlos, mal aufbäumend, mal erschöpft. Nur ein einziges Mal wird sie zur Wasserflasche greifen. Radikalperformativ arbeitet sie gegen die versperrten Zugänge und verstopften Ausgänge des Textgefängnisses an und will sich ganz offensichtlich aus der Enge der paranoiden Projektionen des selbstgeschaffenen Labyrinths befreien. Aber ganz offenbar geht es ihr nicht nur um den literarischen Text, es geht ihr um mehr. Neben ihrem Kopf erscheint im Raum die filmische Projektion eines überdimensionierten Closeup ihres Kopfes. Die paranoiden Imaginationen scheinen sich zu verdoppeln, sie greifen in den Raum, werden ausgelagert. Und dennoch bewegt sich die Performerin auf ihrem Rennrad keinen einzigen Millimeter vorwärts. Eine am Rollentrainer montierte App übersetzt das raumlose Durch-Fahren des Raumes in eine Umgebungssimulation. Mit diesen Bildern wurden die Besucher*innen auf einem am Eingang der studio.box installierten Monitor empfangen. Während Kafka aus dem Closed Circuit einen textlichen Ausweg anbietet, indem er den letzten Satz seiner Erzählung offen hält, verschließt ihn sein Herausgeber Max Brod. Der 1931 posthum publizierte letzte Satz heißt: „Aber alles blieb unverändert.“ Dabei hatte es geheißen: „Aber alles blieb unverändert, das – “. Bazrafshan übersetzt Kafkas Erzählung 2024 in der studio.box des Erfurter Theaters in eine multimediale, kinematografisch-installative Performance, die die Rezipient*innen ungehindert durchlaufen können. Und hierin findet sie ihren Ausweg: Mit den Mitteln der Ästhetik verhindert Bazrafshan die Verödungsgefahr des geschlossenen Systems, das durch die Kürzung des letzten Satzes an das Lesepublikum übergeben wurde. Denn parallel zu den körperlichen Anstrengungen der Performerin, gegen das allegorische Gefängnis anzufahren, weitet Bazrafshan den Theaterraum. Sie lüftet mit Bildern, medialisiert mit Digitalität, mobilisiert die Gattungen und bringt die Rezipient*innen wie das Publikum der bildenden (und nicht der darstellenden) Künste in Bewegung. Damit entlässt sie uns mit hoffnungsvollen Aussichten – sowohl auf die Potentiale der Künste als auch auf die Sinnhaftigkeit offener Systeme. Der Dramaturg und Intendant Matthias Lilienthal formulierte 2010 in der Akademie der Künste, für ihn sei Theater, wenn Menschen davorstünden und glaubten, es sei Theater. Friedman im Gespräch mit Barrie Kosky und Christian Schertz zum Thema Kunstfreiheit lässt das Dargebotene in diesem Sinn auch als ein Theaterstück einordnen. Am 13.06.2024 wurde Friedman im Gespräch mit Barrie Kosky und Christian Schertz zum Thema Kunstfreiheit im Großen Haus des Berliner Ensembles uraufgeführt. Bei diesem Stück sitzt der Gastgeber Michel Friedman (gespielt von Michel Friedman) in der Mitte der Bühne auf einem Sesselstuhl und ist als Einziger frontal zum Publikum ausgerichtet. Die beiden Gesprächspartner, Christian Schertz in der Rolle des Medienanwalts Christian Schertz und Barrie Kosky in der Rolle des Opern- und Theaterregisseurs sowie ehemaligen Intendanten der Berliner Komischen Oper Barrie Kosky, sitzen im rechten Winkel zu ihm und richten ihren Blick dadurch zumeist vom Publikum abgewendet in Richtung Friedman aus. Am Ende des knapp 90-minütigen Einakters erheben sich die drei Darsteller und stehen dem Publikum zugewandt zwischen den Sesselstühlen und der Bühnenrampe. Das Publikum applaudiert. Kosky und Scherz stehen für diesen Applaus auf gleicher Höhe wenige Schritte vor der Rampe, Friedman etwas dahinter zwischen ihnen. Näherungsweise verneigen sich Kosky und Schertz, Friedman breitet seine Arme aus. Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum sind in einem One-to-many-Format nicht eingeplant. Ob es weitere Aufführungen geben wird, ist nicht bekannt. Soweit zum theatralen Setting dieses prozessualen Theaterstücks und der hier aufgerufenen Theaternomenklatur. Auch wenn, wie in diesem Rahmen zu erwarten war, nicht alle aktuellen Fragen um das Thema Kunstfreiheit thematisiert oder sogar beantwortet wurden, war der Abend ein interessanter Auftakt, ein paar blinde Flecke deutscher Gegenwartsauseinandersetzungen anzugehen bzw. den medial und politisch dargebotenen Ver(w)irrungen im- und explizit etwas zu entgegnen. Fortsetzungen sind daher auch in anderer Personenkonstellation erwünscht. Einiges blieb dennoch unscharf oder auch unpräzise oder hatte – wie etwa die Passagen über geforderte Wortbereinigungen bei Pippi Langstrumpf oder Karl May – mit der Kunstfreiheit nicht direkt zu tun. Denn hierbei geht es um aus heutiger Sicht kritisierbare Textpassagen im Konflikt mit den Wünschen von zumeist Rechtsnachfolger:innen, ihre bisher bestehenden Auswertungsmaschinen fortbestehen zu lassen. Zwar ist sowohl der Werkbereich als auch der Wirkbereich künstlerischen Schaffens durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützt, wie das Bundesverfassungsgericht 2019 verdeutlichte (1 BvR 1738/16). Künstler:innen steht aber kein Recht zu, in einem bestimmten Medium, auf einem bestimmten Sendeplatz oder in einer bestimmten Ausstellung gezeigt, gehört oder präsentiert zu werden. Sollte den Rechteinhaber:innen die Bearbeitung eines historischen Werkes also missfallen oder sogar testamentarisch untersagt worden sein, darf das Werk dennoch in seiner bisherigen Form fortbestehen und auch dargeboten werden. Wenn aber zum Beispiel ein TV-Sender eine nicht überarbeitete Ausstrahlung ablehnt, können die Rechteinhaber:innen andere Verbreitungsformen für das Original suchen. Genauso wenig, wie die Verbreitung eines Kunstwerkes der bildenden Kunst im Rahmen einer bestimmten Ausstellung verlangt werden kann, haben Radio- und Fernsehsender das Recht, ihre Inhalte weitgehend selbst auszuwählen. Dies gewährleistet Art. 5 Abs. 1 GG. Die Kunstfreiheit wird hier genauso wenig eingeschränkt, wie Werke durch ihre Nichtberücksichtigung eingeschränkt worden sind, die zur Zeit der Entscheidung von Fernsehsendern für das Ausstrahlen von Pippi Langstrumpf, von Winnetou und Old Shatterhand nicht zum Zuge gekommen sind. Christian Schertz plädierte entschieden für eine Trennung von Autor und Werk, wie er am Beispiel von Richard Wagner oder Michael Jackson und deren musikalischen Werken festzumachen suchte. Ein Rausschneiden einzelner Sequenzen wäre aus seiner Sicht in keiner künstlerischen Gattung angebracht, weder in bildenden oder darstellenden noch satirischen Kunstformen. Still wurde es im Saal, als Friedman überleitete: „Gut, dann sind wir bei der documenta, dann schauen wir uns das eine Bild an [Anm.: Gemeint war wohl das Bild People’s Justice von Taring Padi] …und dann schneide ich diese zwei, drei Teile raus?“ Schertz, der sich zu dem Bild an diesem Abend nicht final äußern wollte, weil er den documenta-Fall zu wenig kenne, fügte an, dass ein Rausschneiden für ihn nicht in Frage käme. Man hätte aber sagen müssen, dass dieses Bild nicht gezeigt würde. Ob man dann aber das Ganze abbauen und weghängen muss, weil es in Teilen bestimmte Bevölkerungsgruppen verletze, schätzte er im Sinne einer Bilderstürmerei als schwierig ein. Barrie Kosky wies in diesem Zusammenhang auf die problematische, tief widersprüchliche und komplexe Geschichte Deutschlands mit den Juden und Jüdinnen hin. Das Thema würde ihn nicht nur bereits sein gesamtes Leben beschäftigen, sondern für ihn auch nie enden. Er hätte das inkriminierte Bild vor Ort gesehen und sei, wie er formulierte, „ein bisschen unbequem“ damit. Wenn aber in Deutschland irgendetwas mit Kultur verboten werden soll, erfasse ihn immer „ein Zittern“. Wäre er documenta-Intendant gewesen, hätte er erstens vor allem kein schwarzes Tuch über das Bild gehängt und wäre er zweitens mit den Menschen in einen konstruktiven Dialog eingetreten. Es darf nicht heißen: „Du blöder, furchtbarer, indonesischer, muslimischer Künstler, geh zurück nach Jakarta, geh raus aus unserem Land.“ Geradezu lächerlich war für Kosky die Debatte, weil in Kassel parallel in einem Museum eine Porzellan-Figur, die eine antisemitische Repräsentation darstellt, völlig ohne Kontextualisierung gezeigt wurde und niemand darüber sprach. Auf die Mohammed-Karikaturen angesprochen, wies Schertz darauf hin, dass Satire dann einschränkbar ist, wenn sie einen anderen Menschen in seiner Menschenwürde verletzt. Die Karikaturen waren demnach zulässig, weil sie keinen konkreten Menschen verletzt haben. Implizit trug Schertz damit auch eine Antwort auf die Frage bei, ob die Arbeit von Taring Padi auf dem Friedrichsplatz in Kassel von der Kunstfreiheit geschützt ist. Diese Einschätzung verstärkte Schertz über Bande noch einmal, als er darauf aufmerksam machte, dass die Kunst viel mehr als alle anderen dürfe, auch viel mehr als die Bild-Zeitung. Wenn nämlich Zeitungen das inkriminierte Bild abdruckten, um zur Berichterstattung über Zeitgeschehnisse beizutragen oder um zuweilen auch ihre Empörungen zu veranschaulichen, dann ließe sich ergänzen: Was im Rahmen der Meinungs- und Pressefreiheit zu zeigen erlaubt ist, ist es im Rahmen der Kunstfreiheit allemal. Wo genau Christian Schertz, als einer der zwei Juristen in der Runde, die Grenzen für die Kunst sieht, wurde nicht ganz deutlich und ließ sich auch durch eine anschließende Nachfrage per Mail nicht aufklären. Zunächst merkte er an: „Die Kunstfreiheit wird begrenzt durch die Rechte des Individums, durch die Menschenwürde.“ Und etwas später: „Wenn ein Kunstwerk im Einzelfall aufgrund der konkreten Gestaltung entweder die Würde eines bestimmten Menschen verletzt, wo die Menschenwürde überwiegt oder auch Straftaten erfüllt sind, die etwa den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, dann darf es ausnahmsweise verboten werden.“ Empirisch mag dies so einzuordnen sein, wie verschiedene Verfahren in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gezeigt haben. Wie die Entscheidung zum Werk Esra von 2003 zeigt, sind gleichwohl auch hier wiederum enge Grenzen für die Menschenwürde zu berücksichtigen. Rechtsdogmatisch könnten aber wohl auch andere Verfassungsnormen, mindestens die Grundrechte in Konkurrenz zur Kunstfreiheit treten. Boykott-Aufrufe gegenüber Künstler:innen, zum einen durch die BDS-Bewegung, zum anderen gegenüber in Russland lebenden oder aus Russland stammenden Künstler:innen, die sich nicht offen von etwas distanzieren oder für etwas aussprechen, sahen sowohl Kosky als auch Schertz problematisch. Kosky machte hier auf die besondere Rolle von Kunst aufmerksam. Auch wenn das Theaterstück in seiner Inszenierung unvollständige Passagen trug oder wie Kosky an anderer Stelle anmerkte, sich das Publikum vielleicht mit manchem unwohl oder unbequem fühlen könnte: Es war in dieser Zeit richtig, es zur Aufführung zu bringen. Vielleicht ließen sich künftig aber auch ein paar Fesseln des Theaters neu interpretieren. https://www.berliner-ensemble.de/friedman Zu Tania Brugueras „Where Your Ideas Become Civic Actions (100 Hours Reading The Origins of Totalitarianism“ in einer Berliner Kunstinstitution. Der Ausstellungsflyer trägt eine goldgelbe Vintage Patina. Auf einem Foto sitzt Tania Bruguera in einem korbgeflochtenen Schaukelstuhl, inmitten eines Lichtkegels, sie hält in der linken Hand ein Mikrofon mit angeschlossenem Kabel, das nach links aus dem Bild führt. In einer Detailaufnahme ist das Mikrofonkabel in den Fokus genommen, in einer anderen sind notdürftig gekittete Wandrisse angedeutet. Die Patina erzählt, dass die hier porträtierte Szene aus einer Zeit stammt, in der die gesundheitsschädlichen, chemisch hergestellten Daguerreotypien Goldtonungen hervorbrachten. Dabei fand sie vor knapp neun Jahren, Ende Mai 2015, in Havanna statt, zeitgleich mit der Eröffnung der 12. Havanna Biennale und der Gründungsfeier der Republik Kuba. Bruguera stand unter Hausarrest und wartete auf die Rückgabe ihres Passes, der ihr auf dem Weg zu einer ihrer Performances im öffentlichen Raum Havannas Ende Dezember 2014 abgenommen wurde. Sie wurde wegen Widerstand gegen die Festnahme und Anstiftung zu öffentlichem Fehlverhalten und Kriminalität angeklagt. Während ihres insgesamt acht monatigen Hausarrests initiierte Bruguera im Mai 2015 eine 100-stündige öffentliche kollektive Lesung von „The Origins of Totalitarianism“ von Hannah Arendt, das als Arendts politisches Hauptwerk gilt. 1955 unter dem Titel „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ auf Deutsch erschienen, führt Ahrendt hierin zu der historischen Entstehung und den gemeinsamen politischen Merkmalen von Nationalsozialismus und Stalinismus aus. Es gilt als Standardwerk der Totalitarismusforschung, dessen Lesung vor neun Jahren durch Bruguera mit ihrer mehrstündiger Festnahme endete, bevor sie im Juni 2015 erneut verhaftet wurde, als sie an einer Demonstration teilnahm. Bruguera setzt damit Arendts Totalitarismusstudie und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen in Kuba in eins, Ursachen und Folgen gehen ineinander über: sie liest gegen den Totalitarismus in Kuba an, der Totalitarismus Kubas schlägt zu, weil sie liest. 100 Stunden lang lasen und diskutierten die Teilnehmer:innen, darunter die Kunsthistorikerin Judith Rodenbeck und der Kurator des Guggenheim UBS MAP Latin America, Pablo Leon de la Barra, Arendts Studie über totalitäre Systeme, die in Kuba bis heute von großer Bedeutung ist. Diese Aktion bildete den Höhepunkt der Kampagne #YoTambiénExijo (I also demand), die Bruguera mit einer Gruppe kubanischer Kolleg:innen in den Jahren 2014/15 initiierte. Die Ereignisse dieser Zeit sind detailliert auf Brugueras Webseite dokumentiert. Diese Aktion gilt auch als Start des Gründungsprozesses des Hannah Arendt International Institute of Artivism (INSTAR). INSTAR ist ein Akronym, bedeutet aber auch „ermutigen“ und „anstiften“, engagiert sich als Institution für Bildung und soziale Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, gerechte Löhne und Arbeitszeiten, bessere Arbeitsbedingungen für Alleinerziehende und gegen Diskriminierung. Knapp neun Jahre später liest Bruguera aus Arendts Werk in der historischen Halle des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Für 100* ununterbrochene* Stunden vom 7.2.24, 19 Uhr bis 11.2.24, 23 Uhr* liest sie und lesen Aktivist:innen, Theoretiker:innen, Autor:innen, Schauspieler*innen, unter ihnen Masha Gessen, Juliane Rebentisch, Jörg Heiser, Stefan Römer und Thomas Lindenberger, Direktor des Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung (an der TU Dresden). Im Stundentakt übergeben sie sich das Mikrofon mit angeschlossenem Kabel, das nach links aus dem Bild führt, sie sitzen in einem korbgeflochtenen Schaukelstuhl, inmitten eines Lichtkegels. Vor ihnen sitzen Zuhörer:innen, die rund um die Uhr, ohne Anmeldung und kostenfrei an der Performance teilnehmen können, die nun „Where Your Ideas Become Civic Actions (100 Hours Reading The Origins of Totalitarianism“ heisst. Im Eingangsbereich informiert ein unübersehbarer „Verhaltenskodex“, dass sich hier mit Toleranz und gegenseitigem Respekt begegnet wird. Hier würde sich gegen jede Form von Hass und Diskriminierung etwa in Form von Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit ausgesprochen. Brugueras Reenactment ihrer Lesung in ihrem Wohnhaus in Havanna findet nun als eine Performance in einer Berliner Kunstinstitution statt. Sie wieder-holt wesentlich konstitutive Elemente, selbst der Lautsprecher, der in Havana ausserhalb des Gebäudes installiert war, ist hier an der Invalidenstraße positioniert und sendet die Lesung in den Berliner Raum. Auf die weiße Taube wurde verzichtet, die schon bei Brugueras früheren Performances wie „Tatlin’s Whisper #6 (Havana Version)“ 2009 eingesetzt wurde. Sie zitiert die Tauben, die Fidel Castro während seiner erster Rede 1959 nach der Kubanischen Revolution umflatterten. Doch das Reenactment suspendiert noch einiges mehr und zahlt damit einen hohen Preis: Statt das Werk Arendts zu entverschließen, verhinderte die Akustik der Halle und die Mediatisierung der Stimmen durch das Mikrofon genau dieses Anliegen. Statt eine gemeinsame Situation des „Nachdenkens und Redens“ (Zitat aus dem Ausstellungsflyer) zu kreieren, saßen die sich abwechselnd Lesenden frontal, vereinzelt und vereinsamt dem Publikum gegenüber. Statt eine „Pluralität von Perspektiven und Welten“ (Zitat aus dem Ausstellungsflyer) zu generieren, wurde eine One-to-Many-Kommunikation hergestellt, die Pluralität einhegte. Statt „die Aktualität von Arendts Analysen von Totalitarismus, Antisemitismus, Vertreibung und Staatenlosigkeit“ (Zitat aus dem Ausstellungsflyer) auf eine Öffentlichkeit treffen zu lassen oder eine Öffentlichkeit zu generieren, verschloss die Institution Kunstmuseum performativ und verengte zu einer Milieubegegnung. Auf ästhetischer, politischer und erkenntnistheoretischer Ebene fanden damit Verluste statt. Im Gegenzug dazu wurde die Lesung als reenactete Performance nun in den kunsthistorischen Kanon aufgenommen beziehungsweise ihre Anwesenheit im Kanon verbrieft. Sie wurde mit einem Titel ausgestattet, der an Harald Szeemans legendären „When Attitudes Become Form“ (1969 in Basel) anschließt. Sie fand in einer westeuropäischen Kunstinstitution statt, die Teil der Staatlichen Museen zu Berlin ist und an der öffentliche und institutionalisierte Personen des Kunstbetriebs teilnahmen. Und sie wurde genrefiziert mit der Gattung sowohl der Performance als auch des künstlerischen Reenactments. Damit wird, und das ist ein wichtiger Gewinn dieses Mediatisierungs- und Institutionalisierungsprozesses, Brugueras Arbeit fortgesetzt legitimiert und geschützt*. Schon auf der documenta 15 wurden (kunst-) institutionalisierende Maßnahmen eingesetzt, als Bruguera und INSTAR in der documenta-Halle eine Gegenerzählung zur offiziellen kubanischen Kultur- und Kunstgeschichte erzählten, mit der sie von der kubanischen Regierung zensierte Künstler:innen und Intellektuelle Gehör verschafften. Hierfür wurden viele kubanische Kolleg:innen nach Deutschland eingeladen, einige von ihnen sagten ab, aus Sorge, nicht nach Kuba zurückkehren zu dürfen. Die Kunstinstitution wird so zu einem Ort des Schutzes* und einer infrastrukturellen Ermöglichungsbedingung* für zivilgesellschaftliche Gemeinsamkeiten*, zu einem Raum des kollektiven und kunsthistorischen Gedächtnisses und ein Öffentlichkeitstool für Gegenerzählungen. Gleichzeitig gelingt aber auch der Kunstinstitution mit diesem Reenactment, ihre Ablehnung von Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit zu bekunden – eine Haltung, die spätestens seit der documenta 15 zunehmend in Zweifel gezogen wird und in der Berliner Antisemitismusklausel mündete. Aber das wäre eine andere Geschichte – oder doch nicht* …? Weitere Informationen hier: Spiegel Online, 12.2.2024: https://archive.is/YIDKi Jüdisches Museum Frankfurt @jmfrankfurt.bsky.social, 14.2.2024: https://bsky.app/profile/jmfrankfurt.bsky.social/post/3klf7aovw7t24 Journal Frankfurt, 15.2.2024: https://www.journal-frankfurt.de/journal_news/Politik-10/Antisemitischer-Angriff-bei-Lesung-Solidaritaetslesung-fuer-Mirjam-Wenzel-in-Frankfurt-41969.html Commentary, 13.2.2024: https://www.commentary.org/seth-mandel/the-israel-obsessed-art-world-devours-itself/ Frankfurter Allgemeine, 19.2.2024: https://archive.ph/2024.02.19-172054/https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/mirjam-wenzel-ueber-hassreden-im-hamburger-bahnhof-19530908.html „Dies ist keine Botschaft (Made in Taiwan)“ lautet der Titel der neuesten Rimini-Protokoll-Produktion (Stefan Kaegi) im Rahmen der Performing Arts Season der Berliner Festspiele 2023/24. Dieser Satz ist inmitten der Repräsentationsmaschine Theater und des Performanzformats so wahr, wie er falsch ist, so wenig wahr, wie er wenig falsch ist. Das hatte bereits René Magrittes Ölgemälde „Ceci n’est pas une pipe“ bildnerisch belegt, indem Magritte unter die plakativ-realistische Abbildung einer Pfeife auf einer Leinwand schrieb: „Ceci n’est pas une pipe.“, das ist keine Pfeife, obgleich es sich doch um eine Pfeife handelte. Darstellung (Signifikat), Bezeichnung (Signifikant) und tatsächliches „Ding“ sind zu unterscheiden. C’est une embassade. Ceci n’est pas une embassade. Für zwei Stunden entstand auf der großen Bühne des Berliner Festspielhauses die Botschaft Taiwans. Die Musikerin Debby Szu-Ya Wang, die Digitalaktivistin Chiayo Kuo und der ehemalige Diplomat David Chienkuo Wu – alle drei auf ihre je eigene Art Botschafter*innen ihres Landes – riefen mit ihrer Performance und damit mit einer performativen Äußerung auf der Theaterbühne im Schutz der Kunstfreiheit die von ihnen vermisste diplomatische Vertretung ihres Heimatlandes in Deutschland aus. Nicht nur hier würde eine Botschaft fehlen, in nur zwölf Ländern würden Taiwans diplomatische Vertretungen den Status einer Botschaft haben, in Europa nur in Vatikanstadt – und das, obwohl Taiwan zu den zwanzig größten Wirtschaftsregionen der Welt zähle. Aber keine Nation könne es sich leisten, die Beziehungen zur Wirtschaftsmacht China zu gefährden. Selbst seinen Sitz in den Vereinten Nationen musste Taiwan 1971 aufgeben, als der US-amerikanische Präsident Richard Nixon entschied, die politischen Beziehungen zu China zu intensivieren. Auch bei den Olympischen Spielen tritt Taiwan seit 1984 unter dem Namen Chinesisch Taipeh an und darf auf den Zeremonien weder seine Flagge zeigen, noch darf die Nationalhymne gespielt werden. Seither kämpft Taiwan um diplomatische Anerkennung und damit auch um seine politische Repräsentanz. Diese wurde nun an drei Abenden im Berliner Festspielhaus temporär performiert: unter anderem mit der Flagge Taiwans und einem am Bühnenhaus fixierten goldglänzenden Messingschild ausgewiesen, mit der Nationalhymne in Karaokeversion zu Gehör gebracht und mit dem Publikum als Besucher*innen eines Botschaftsempfangs in Szene gesetzt. Hierbei handelte es sich um die Bestandteile, die in performativer Funktion einen konkreten Handlungsvollzug von Botschaft als Botschaft praktizierten – und dies in doppelt semantischem Sinne: Hier wurde nicht nur eine Botschaft (als embassy) performiert, hier wurde auch eine Botschaft (als message) kundgetan. „Bitte vergesst uns nicht!“ Performative Äußerungen vollziehen die Wirklichkeit, die sie beschreiben, selbst mit – und bringen sie so erst hervor. Diese Äußerungen tun durch die Äußerung selbst etwas; etwas, das nicht wahr oder falsch ist, sondern das glücken kann oder eben nicht (J.L. Austin 1986: Performative Äusserungen). „Dies ist keine Botschaft (Made in Taiwan)“ ist geglückt. © Claudia Ndebele C’est un message. Ceci n’est pas un message. Die Theaterbühne und das künstlerische Format der Performance konnte das Defizit fehlender Repräsentanz für zwei Stunden aufheben: Mit Mitteln der erzählerischen und bildlichen Montage und Collage entstand im ausverkauften Haus der Berliner Festspiele eine Erzählung Taiwans, die historische, politische, soziale und wirtschaftliche Dimensionen des Landes mit persönlichen Biografien verwob. Debby Szu-Ya Wang, Chiayo Kuo und David Chienkuo Wu erzählten von sich, ihren Lebenswegen und Familien. Sie verknüpften ihre mikropolitischen Geschichten mit soziopolitischen Ereignissen Taiwans, etwa mit der Gründung Taiwans durch Rückzug der Unterlegenen der Kommunistischen Partei aus der Volksrepublik China 1949, mit dem Personenkult um den Gründer Chiang Kai-shek und der Ende der 1980er Jahre beginnenden Demokratisierung. Sie erzählten von sozioökonomischen Entwicklungen als Halbleiterproduzent oder als Bubble-Tea-Erfinder, von Landesbezeichnungsdebatten (Taiwan vs. Republik China), von Religions- und Sprachenvielfalt der Inseln. Die umstrittene völkerrechtliche Stellung Taiwans würde sich in den tektonischen Erschütterungen zwischen unterschiedlichen Politiksystemen wiederfinden, aber auch durch Taiwans geologische Lage innerhalb des pazifischen Feuerrings, die immer wieder zu starken Erdbeben führen. Die sprachlichen Erzählungen wurden zusätzlich ins Bild gesetzt: mittels Miniaturmodellen von Architekturen und Personen, die wiederum durch Videoprojektionen auf der Bühne großformatig sichtbar gemacht wurden, mittels auf der Bühne von Debby produzierter Klänge und Kompositionen, aber auch mittels projizierter Privatfotografien von Debby, Chiayo und David. Selbst ihr performiertes Demokratiekonzept machten sie ansichtig: Konträre Einschätzungen ihrer jeweilig erzählten Perspektiven wurden durch Widerspruchsschilder kommentiert: „I disagree“, hieß es durch Chiayo, wenn David von einer Wiedervereinigung mit dem Festland China schwärmte oder durch David, wenn Chiayo den Staatsgründer Chiang Kai-shek als Militärdiktator bezeichnete. Dass es sich bei den Berliner Festspielen um eine direkt vom Bund getragene und finanzierte Einrichtung handelt, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien als Aufsichtsratsvorsitzende zumindest geschäftlich unmittelbare Vorgesetzte des Intendanten des Hauses ist, reicherte die Doppelbödigkeit, dass hier keine Botschaft performiert würde, obwohl hier eine Botschaft i.S. einer embassy und einer message performiert wurde, um eine nächste, um eine politisch-infrastrukturelle Bedeutungsebene an. Im Zeichen der Kunstfreiheit und mit der Kraft der performativen Äußerung wurde die künstlerische Performance zu einer politischen, das Theater temporär zu einer „Bühne der Weltpolitik“. Im Gewirr der Mehrfachbedeutungskonstruktionen und -zuschreibungen konnten daraufhin im Publikum unter den Gästen des performierten Botschaftsempfangs auch die aktuelle Aussenministerin und der CEO der Volkswagen AG ausfindig gemacht werden. Somit fand auch das Publikum inmitten von Struktur, Zeichen und Spiel (Derrida 1972) seine Rolle/n und ließ sich auf das Spiel zwischen Abwesenheit und Präsenz des Zeichens ein. © Claudia Ndebele Das ist (k)eine Botschaft. Zum Ende des Abends blinkte auf der Rückseite des Bühnenhauses ein taiwanesisches Schriftzeichen, eine Kombination von ‚Nation‘ und ‚vielleicht‘, von ‚nation‘ und ‚maybe‘: Das Schriftzeichen wurde als Leuchtzeichen nur in einen der beiden Zustände versetzt: entweder als ‚Nation‘ oder als ‚vielleicht‘. Dabei belegte „Dies ist keine Botschaft (Made in Taiwan)“ in just dem Moment des Vollzugs, dass mehrere Zustände gleichzeitig funktionieren, sowohl eine Botschaft zu sein, als auch keine, sowohl eine Botschaft zu haben, als auch keine. Das goldglänzende Messingschild wurde nach zwei Stunden, unter großem Applaus des Publikums für die drei Erzähler*innen des Abends und „Experten des Alltags“, demontiert. © Claudia Ndebele 24., 26., 27.01.2024, Uraufführung Haus der Berliner Festspiele, Große Bühne Eine Produktion von Théâtre Vidy-Lausanne und National Theater & Concert Hall Taipei in Koproduktion mit Rimini Apparat, Berliner Festspiele, Volkstheater Wien, Centro Dramático Nacional Madrid, Zürcher Theater Spektakel, Festival d’Automne à Paris, National Theatre Drama / Prague Crossroads Festival mit Unterstützung von Centre Culturel de Taiwan à Paris und Prix Tremplin Leenaards / La Manufacture. „The Great Repair“ in der Akademie der Künste Berlin, 14.10.2023 bis 14.1.2024 Der Ausstellungsparcour begann unerwartet: Statt die imposante freistehende Haupttreppe zu den Ausstellungsräumen innerhalb des Kubus (errichtet 1960, projektiert von Werner Düttmann) zu nehmen, wurden die Besucher*innen zu einer erstmalig geöffneten, zweiflügeligen Funktionstür geführt, die sonst durch die Tische des Cafés Düttmann verstellt ist. Dieser Para-flow führte durch einen Funktionstrakt, quasi durch einen Teil des Maschinenraums der Akademie der Künste am Hanseatenweg, der Öffentlichkeit ansonsten nicht zugänglich. Neben ersten Fotografien zielte der Aufschlag in diesem Nebentrakt auf eine Serie architektonischer Interventionen, mit denen der Düttmannbau selbst zum Objekt der Ausstellung wurde. An der ungedämmten Außenwand zeigten sich, so informierte eine unscheinbare A4-formatige Tafel in der Typo des Ausstellungsprojektes, „bauphysikalische Vorgänge: Die in der Wand kondensierende Luftfeuchtigkeit trifft auf die Wärme des Heizkörpers und die Luftzirkulation zwischen Heizkörper und Fenster. Das führt zu kleinen Spannungsrissen an der Wandoberfläche“. Hierbei handelte es sich um eine von neun Tafeln, verteilt im gesamten Ausstellungsraum, die Auskunft zu Analyse- und Interventionsanmerkungen des Architekturbüros Brenne gaben, das zwischen 2009 und 2012 die Renovation der Akademie der Künste verantwortete. Für diesen konkreten Fall wurde vorgeschlagen: „Um den sichtbaren Schaden zu beheben, müssten die lose Farbe abgeklopft, die Risse mit einem dampfdurchlässigen Putz ausgebessert und eine Ausgleichsschicht aufgetragen werden.“ Und weiter: „Eine langfristige Lösung würde eine energetische Bilanzierung der Bauteile im Gesamtgefüge erfordern, die Aufschluss über bauphysikalische Zusammenhänge gibt.“ Einen besseren Auftakt hätte das Ausstellungsprojekt nicht setzen können, um den Vorgang des „Reparierens“, so das Thema der Ausstellung in dem Blick zu nehmen, indem es erstens den Vorgang des „Reparierens“ selbst thematisierte und zweitens in optische, repräsentative, punktuelle Ausbesserungen einerseits und grundlegende, substanzielle, systemische Reparaturen andererseits differenzierte. Damit signalisierten diese interventionistischen Tafeln in Kombination mit einem abgleichenden Blick in situ, dass Reparaturen offenbar ortsspezifisch, kontextuell, prozessual, personenabhängig, mehrdimensional ausfallen, dass immer auch mehr als eine Lösung möglich ist und dass sie mit Entscheidungen zusammenhängen, die getroffen werden können bzw. müssen. Dieser Auftakt wurde im großen Saal der Akademie mit zwei Arbeiten aus der Kunst flankiert: Rechter Hand das „Maintenance Manifesto“ der New Yorker Konzeptkünstlerin Mierle Laderman Ukeles, in dem sie sich 1969 dafür ausgesprochen hat, tägliche Alltags- und Pflegehandlungen, Wartungs- und Sorgearbeit als Teil ihrer Kunst und damit als Kunst anzuerkennen: „Now I will simply do these maintenance everyday things, and flush them up to consciousness, exhibit thema, as Art.“ Linker Hand war die Arbeit von Zara Pfeifer zu sehen, die im Auftrag von „The Great Repair“ die Arbeitsutensilien der Reinigungsfirma ausstellt, die für die Pflege der Akademie der Künste zuständig ist. Ukeles bedankte sich im Rahmen ihrer Arbeit „Touch Sanitation“ zwischen 1979 bis 1980 bei der städtischen Müllabfuhr von New York, indem sie jeden einzelnem Arbeiter mit Dank die Hand schüttelte – Pfeifer zeigte mit „Maintaining the Akademie der Künste“ installativ die Pflegearbeit der Firma „Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft“ und nannte es „Verkörpertes Wissen“. Damit endete aber auch schon der interventionistische, ortsspezifische und situative Bezug zur AdK. Im Verlauf der Ausstellung in den drei Hallen der Akademie folgten nun 40 Einzelpositionen aus Kunst und Architektur, die das Thema „Repair“ anfassbar und als neues Gestaltungsparadigma greifbar machen sollten – Positionen, die allerdings zum Teil auch in anderen Themenzusammenhängen, wie zum Beispiel im Rahmen ökologisierender Mikropraktiken hätten gezeigt werden können. Thematisch handelte es sich – hier eine Auswahl – um die Pflege und Reparatur von Stahlbeton, um liebevoll reparierte Stühle, um eine kontinuierliche Haussanierung in Tokio zeitgleich zu dessen Weiternutzung und einer Familiengründung, um akustische Vogelscheuchen im Westjordanland, die Wildschweine von Ernten fernhalten sollen, um Müllsammelaktionen am Atitlán-See in Guatemala, um Protestaktivitäten im Rheinischen Revier, der Region um den Tagebau Hambach gegen die Kommerzialisierung von erneuerbaren Energien durch RWE, um das selbstständige Herstellen und Montieren von Schildern, die das Territorium Maraiwatsédé in Brasilien als zu schützendes Land ausweisen oder um das Vernähen von abgetragenen Saris und Lungis zu mehrlagigen Decken in Bangladesch. Ein 21-minütiges Video informierte über die Bombardierung des Theaters von Mariupol durch russische Flugzeuge im März 2022, die Forensic Architecture mittels Zeugenaussagen, Social-Media-Posts, Videos und Fotografien als Kriegsverbrechen dokumentierte. Diese Dokumentation kann als Beweismittel vor internationalen Gerichten oder als Quelle für dessen Rekonstruktion dienen. Unterteilt waren die künstlerischen, architektonischen und aktionistischen Beiträge in Einzelkapitel wie „Mit dem Alltag beginnen“, „Wissenswelten dekolonisieren“, „Werkzeuge für alle“ und „Die Narben sichtbar lassen“. Der finale Saal der Akademie, in denen die Besucher*innen durch einen neu installierten Bypass über den bepflanzten Innenhof gelangten, diente der Frage nach den Praktiken und Instrumenten im Dienste der Reparatur: Wie kann die Architektur selbst, ihre Lehre und Autor*inschaft, ihre Hochschulen, Büros und Baustellen transformiert werden? Hierzu informierten unter anderem ein Reparatur-Kurs, ein globales Moratorium, mit dem das Bauen gänzlich ausgesetzt würde, die Gründung der Grassroot-Gewerkschaft UVW-SAW für Architekturschaffende in Großbritannien und abschließend ein „Demolition Moratorium“, das den Erhalt oder Umbau aller Gebäude und zwar erst nach einer erfolgreichen sozioökologischen Bewertung auf der Grundlage des Gemeinwohls forderte. Die Ausstellungsmacher*innen, und hierbei handelt es sich um Architekt*innen und Stadtforscher*innen, nannten ihr Projekt – ein Projekt von ARCH+ gGmbH, in Kooperation mit der Akademie der Künste, Berlin, dem Departement für Architektur der ETH Zürich und der Faculté des Sciences Humaines der Universität Luxemburg – „The Great Repair“. Mit der Ausstellung schloss ARCH+ an den diesjährigen Architekturbiennalebeitrag im Deutschen Pavillon an. Für die gezeigten Raumpraktiken wirkte der Titel unpassend verhoben. Warum eine neue Epoche, eine große Erzählung ausrufen, wenn es sich um bereits existierende, aber eben minoritär behandelte Praktiken handelt, die entdeckt, praktiziert, gewertschätzt werden und zirkulieren müssen? „The Great Repair“ erinnert an „The Great Reset“, der Initiative des Weltwirtschaftsforums (WEF), die plante, die Weltwirtschaft und die Weltgesellschaft im Anschluss an die COVID-19-Pandemie neu zu gestalten. Vorläufer hierfür waren „The Great Transformation“ des Wirtschaftssoziologen Karl Polanyi von 1944, in dem er den Wandel der westlichen Gesellschaftsordnung im 19. und 20. Jahrhundert am historischen Beispiel Englands behandelte. Und so werden aktuelle Vorhaben in Superlativ-Logik „The Great Financialization“, „The Great Regression“, „The Great Reversal“ oder auch „The Great Acceleration“ genannt – eine Logik, der die hier versammelten Mikropolitiken und einer sensiblen, poetischen, praxeologischen und ausdifferenzierenden Auffaltung des Themas zuwiderlaufen. Warum nicht einfach „Reparieren!“, wie es im Vermittlungsprogramm der AdK in Form von wöchentlichen Workshops von Reparaturpraktiken praktiziert wurde? Die Dekonstruktion grundlegender Logikprozesse, etwa von Geschichte, Medien und Institutionen, wären hilfreich, um das Anliegen, einem neuen Gestaltungsparadigma Kraft zu verleihen, zu unterstützen. Weitere Links: https://www.adk.de/de/programm/index.htm?we_objectID=65844 https://www.adk.de/de/programm/?we_objectID=65644 Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Hans Sauer Stiftung, die Wüstenrot Stiftung und Pro Helvetia. Das Experimental Stipendienprogramm für junge Architekturforschende wird gefördert durch EXPERIMENTAL. Künstlerische Leitung: Florian Hertweck, Christian Hiller, Markus Krieger, Alex Nehmer, Anh-Linh Ngo, Milica Topalovic Dana Michels Performance „MIKE“ im Berliner Gropius-Bau startete für das Publikum unwissentlich mit einer 30-minütigen Detox-Kur: Die Zuschauer*innen versammelten sich pünktlich zu um 15 Uhr in der 1. Etage des Gropius-Baus. Da sich der Einlass verzögerte, konnten wir am Gelände der Rotunde stehend das palastähnliche Gebäude und dessen kubischen Baukörper, den Materialeinsatz und die Blickachsen registrieren. Wir konnten die anderen wartenden Zuschauer*innen beobachten, das Aufsichtspersonal des Gropius-Baus, die Routinen in der Einlasskontrolle, aber auch die Begrüßungsrituale und Übersprungshandlungen der Besucher*innen. Spätestens nach 10 Minuten wurde das Publikum etwas unruhig, ein Mitarbeiter verschwand in den verschlossenen Trakt Richtung Niederkirchnerstraße, kehrte zurück und schüttelte mit dem Kopf. Ließ Dana Michel uns warten? War sie nicht rechtzeitig vorbereitet? Gab es Schwierigkeiten? Es kam zu ersten verärgerten Blickkomplizenschaften und vereinzelten runzelnden Augenbraunen wegen der nicht eingehaltenen und verabredeten Zeitökonomien. Nach 20 Minuten öffnete sich die raumhohe Eingangstür, uns wurde empfohlen, uns entweder einen weißen Plastikstuhl links des Eingangs oder eine eingerollte Filzdecke rechts des Eingangs zu nehmen, mit denen sich die meisten der Besucher*innen in dem zentralen Raum platzierten und einrichteten. Hier würde wohl jetzt die Performance „MIKE“ stattfinden, zu der die Berliner Festspiele im Rahmen von „Performing Arts Seasons“ eingeladen hatten. Doch auch hier und jetzt passierte scheinbar nichts Substantielles, irgendwann tauchte die Performerin auf, gekleidet in einem braunen Arbeitsanzug, darunter ein weißes Hemd und an den Füßen überlange weiße Strümpfe, mit denen sie auf dem Holzfussboden durch den Trakt rutschte. Es dauerte einige Zeit, bis sich das Publikum mit dem Timing und den Aufenthaltsorten von Dana Michels synchronisierte und die eigenen Präkonfigurationen, Zeit- und Bewegungsökonomien losließ. Für die kommenden zweieinhalb Stunden würden sich etwa 50 Besucher*innen zusammen mit Dana Michel die Räume und die Zeit teilen, sie würden gemeinsam staunen, sie würden Blicke nachvollziehen, Kontexte herstellen und Bewegungen bewundern, sie würden eine gemeinsame Gegenwart und eine gemeinsame Präsenz teilen – wenngleich die vierte Wand des Theaters sie trennen würde, die Dana Michel bis auf eine Ausnahme nicht durchschreiten würde. Die fünf Räume, die der Live Performerin zur Verfügung standen, waren mit verschiedenen Gegenständen und Materialien ausgestattet, die von einem Gebäudemanagement oder einem Umzugsunternehmen verwendet werden könnten: Elektrokabel, eine rollende Stehleuchte, Papierrollen, ein Wasserspender, zwei Bürostühle, gefaltete Pappkartons, Lamellenrollos, Teppichreste, Kabelbinder, Abklebband, Filzdecken, rollende Kleiderständer, aber auch Handwerkszeug, das in weiße Socken gekleidet war und geometrisch angeordnet auf dem Boden lag. Fünf Einzelräume des Gropius-Baus auf einer Länge von etwa 60 Metern, die ansonsten für das Ausstellen von Bilder, Objekten und Installationen genutzt werden, sollten nun das Surrounding werden, in dem Dana Michel die Readymades ihres Readymade-Dasein entledigte, in dem sie das Surrounding und seine Parameter selbst thematisierte und in dem sie Intra-Aktionen herstellte: Zwischen ihrem Körper und einzelnen der aufgereihten Gegenstände entstanden Living Sculptures, wenn sie sich in gleichem Winkel neben die aufrecht stehenden Teppichrollen lehnte, wenn sie sich auf die Stühle setze und sich deren Formen anpasste, wenn sie sich vom Rotlicht der Stehleuchte bescheinen ließ, wenn sie sich auf den ausgerollten Papierrollen ausstreckte oder auf ihnen entlang rutschte, wenn sie in den Zwischenräumen von Bewegungen verblieb und diese dehnte, verzögerte oder perpetuierte. Gleichzeitig entdeckte Dana Michel die Bestandteile der Immobilie, die Heizkörper, an die sie sich presste oder in die sie hineinlauschte, die Elektroschränke, die in die Ausstellungsräume eingepasst sind, die Blickachsen, die Türen, den rutschenden Holzfussboden. Mit ihren Entdeckungen und Bewegungen vermaß Dana Michel die Räume und das Publikum folgte ihr. Wie nur können hier ansonsten Bilder gehängt und Objekte gestellt werden? Eignen sich die räumlichen Verhältnisse nicht vielmehr bzw. verlangen sie es nicht, Strecken zurückzulegen, um die Ecken zu schauen, zurückzublicken, auf dem Boden zu rutschen, sich hinzulegen, sich auszudehnen? Eignen sich Achsen von 60 Metern nicht dafür, Papierrollen auszurollen, sie zu falten, sie zu zerknittern, sie zusammenzuballen, sie mit Klebeband zu bändigen und sie zu rollen. Dana Michel erprobte diese Bewegungen und Handlungen, manchmal war es knapp am Slapstick vorbei, wenn sie beispielsweise einen der Bürostühle verpackte, der sich regelrecht dagegen zu wehren schien. In diesen Momenten wurde verständlich, was Karen Barad mit „Intra-Aktion“ meint: Die beteiligten Akteure (egal ob menschlich oder nicht menschlich) würden miteinander intra-aktionieren und konstituieren sich erst im Rahmen dieser dynamischen Intra-Aktion gegenseitig, an denen sie beteiligt und in die sie verwoben sind. Das hochkonzentrierte Publikum zweifelte keinen Moment an der Ernsthaftigkeit von Dana Michels planvoll scheinenden Handlungen, wenngleich sie nie zu einem teleologischen Ergebnis kamen. Zwar aktivierte sie hin und wieder mal eine Lampe oder schloss ein Stromkabel an den Stromkreislauf an. Allerdings führte auch dies zu keinem expliziten Zweck, der die Ökonomie der Prozesse hätte rechtfertigen können. Vielmehr ergaben sich (mit Aristoteles) andere Arten von Ursachen, die des Materials und die der Form, die ausgiebig zelebriert wurden und denen das Publikum folgte. Entledigt der Zweckursache, innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens und an einem bestimmten Ort eine Kunstperformance zu rezipieren, folgten wir mit Freude Dana Michels alltäglichen Bewegungen, wir schauten mit ihr zurück, um die Ecke oder in den Stromschrank, wir wunderten uns, dass sich der Bürostuhl gegen seine Verpackung wehrte oder hätten gern selbst auf Socken auf dem Holzfussboden rutschen wollen. Der berühmte, im Surrealismus durchgespielte Satz des französischen Dichters Comte de Lautréamont (1868), dass in dem „zufällige[n] Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch“ eine Schönheit lagere, wurde von Dana Michel zu einer hyperrealistischen Formel überführt: Michel zelebrierte eine überscharfe Realität, indem sie Vorgänge zeigte, für die es kaum Bezeichnungen, in jedem Fall kaum Bezeichnungen in der Standardsprache gibt: Fummeln, nesteln, zuppeln, tätscheln, kraulen, scharren, knartschen – Vorgänge, die sich selbst der Materialisierungen von und durch Sprache entziehen, die aber eine eigene Wirkmacht haben und eine Realität erzielen. Diesen Begriffen gab sie im Gropius-Bau eine große Bühne. 1., 2. und 3.12.2023, 180 min ohne Pause, Deutsche Erstaufführung, Uraufführung am 19.5.2023, Kunstenfestivaldesarts Brüssel, Gropius-Bau Berlin Immer wieder unterbricht Selma Selman, tritt ans Mikrofon in die vorderste Reihe, verliest ihre Sätze, platziert auf einem Notenständer, wird rechts und links hinter sich von einer Cellistin und einem Sounddesigner begleitet. Sie startet langsam, bedächtig, verständlich, in unterschiedlichen Sprachen, wird lauter, agressiver, schreit irgendwann in das Mikrofon, „They say that gipsies steal.“, der Sounddesigner verstärkt ihre Stimme, verzerrt den Gehalt des Gesprochenen, die Cellistin verschärft mit quietschenden Tönen. „Who can speak?“ fragen postkoloniale Theorieansätze, Selman schreit – und wechselt in ihrem Text von der 3. in die 1. Person Singular: „She is not lost, she is not going to be found. She is walking now, she is moving, and moving, and it looks like she is fighting the time, she is ahead, she is almost at the time. She is holding herself still and she is Nike, she is about to fly without her head on her. God, make me so famous, so I can escape this place.“ Nach der Zäsur schreitet sie in ihrem weißen, körperbetonten Kleid, durch grau abgesetzte Nähte in perfekter Passform, zurück in den Hintergrund, setzt sich eine schwarze Arbeitsbrille auf, zieht ihre weissen Gummihandschuhe über ihre Hände und fügt sich farblich perfekt ein hinter einem Arbeitstisch und zwischen ihrem Vater, in schwarzer Hose und weißem Hemd und ihrem Cousin, ebenfalls in schwarzer Hose und weißem Hemd. Auch sie sind ausgestattet mit einer schwarzen Arbeitsbrille und weißen Handschuhen. Der Bruder ist krank geworden, sonst hätten sie zu viert im Berliner Gropiusbau mit Äxten Elektroschrott zertrümmert, mit Akkuschraubern aufgeschraubt, von Plastikumschalungen befreit, in Einzelteile zerlegt und von einem Stapel auf den anderen sortiert, immer wieder unterbrochen von Selmas Vortragssequenzen. Währenddessen spielt die Cellistin zu den Klängen des Verschrottens auf ihrem Cello (wer denkt dabei nicht an Charlotte Moormans Cellospiel während der Fluxus-Bewegung?). Der Sounddesigner (wie die Cellistin ebenfalls schwarz-weiß gekleidet) sitzt hinter dem Display seines Notebooks und kreiert Electronic Industrial(sound) in den Raum, der grell erleuchtet und von ca. 70 wechselnden Performancebesucher*innen gefüllt ist. Weitere etwa 200 stehen vor der Glastür und warten auf Einlass. Selma Selmans Perfomance „Motherboard“ findet parallel zu ihrer Einzelausstellung „her0“ in der 1. Etage des Berliner Gropiusbaus statt. „Motherboard“ legt das Motherboard, die Hauptplatine von Personal Computern frei, auf der die operativen Einzelteile des Rechners wie der Hauptprozessor, der Arbeitsspeicher, die PC-Firmware oder andere Erweiterungskarten (z.B. Netzwerkkarten, Grafikkarten, Soundkarten, TV-Karten, Modemkarten etc.) montiert sind. Unter „Trivia“ heißt es in der Wikipedia, dass die Hauptplatine genderunsensibel „Motherboard“ genannt wurde – für Selma Selman eine semantische Vorlage, sich gemeinsam mit ihren männlichen Familienmitgliedern des Motherboards anzunehmen und es lautstark, kühl, technoid, industriell, aggressiv, schwitzend, in grellem Licht und unter Anwesenheit eines großen Publikums im Gropiusbau freizulegen. Es staubt, es splittert, es funkt, es riecht nach Metallischem, für die Besucher*innen werden optional Schutzbrillen und Ohrenstöpsel ausgegeben. Dabei handelt es sich nicht um die erste dieser Performances: Im April diesen Jahres zertrümmerte Selman „Motherboards“ auf Kampnagel, im Rahmen von „Krass Festival 11: Roma City Hamburg“, ein Jahr zuvor ebenfalls auf Kampnagel in „Mercedes Matrix“ an 4 Terminen einen Mercedes-Benz. Im vergangenen Jahr war sie documenta-15-Teilnehmerin und stellte zurückgebliebende Videos und Skulpturen ihrer Performances im Zwehrenturm im Fridericianum aus. 2017 schrie sie auf der Vernissage des 3. Berliner Herbstsalons bis zur Erschöpfung „You have no idea!“ Selma Selman ist Romni aus Bosnien-Herzegowina („Romani origin“) und thematisiert vor unseren Augen im Gropiusbau das ganze Spektrum dessen, was als „Identität“ bezeichnet wird. In „Who needs Identity“ bietet der britische Soziologe und Mitbegründer der Cultural Studies Stuart Hall 1996 eine erste Definition dessen, was er als ‚Identität‘ versteht: Identität sei die „Nahtstelle“ zwischen Diskursen und Praktiken einerseits und Subjektivierungsprozessen andererseits. An der Nahtstelle würde Identität hergestellt, sie sei etwas Veränderbares und auch Auflösbares. Die Nahtstelle überbrücke die Lücke zwischen den in sozialen Diskursen für Individuen vorgesehenen Subjektpositionen einerseits und den Prozessen, die sprechbare (!) Subjekte für sich herstellen. Andere Varianten für „Identität“ sind zum Beispiel Floya Anthias‚ „Erzählungen über Zugehörigkeit“ (2003). Selman kreiert und generiert ihre „Erzählung von Zugehörigkeit“ performativ, aus einer Schnittmenge von geschlechtsspezifischen und rassistischen Diskrimierungen, stereotypen Identitätszuweisungen, Kultur- und Überlebenspraktiken des Recyclings, Familienbeziehungen, neokolonialen und kapitalistischen Diskurs- und Lebensverhältnissen. Mit Stuart Hall wäre ihr Kleid, wären die grauen Nähte ihres Kleides, die ihren Körper formen, nachzeichnen und betonen, die sich absetzen auf dem strahlenden Weiß und in Differenz zu ihren Mitperformer*innen die bedeutungsbildenden symbolischen Formen ihrer „Identität“. Ich möchte daher der Kuratorin der Ausstellung im Gropiusbau Zippora Elders vorschlagen, als Ergebnis der Performance nicht einen goldenen Nagel zu installieren, mit dem das gewonnene Gold materialisiert werden soll, sondern (ebenfalls Titel und Thema „Motherboard“ unterstützend) das Kleid zu präsentieren. Das Kleid wäre nicht nur die Nahtstelle von Vorgesehenem und Selbsthergestelltem, von Diskursen, Praktiken und Subjektivierungsprozessen, sondern auch die gefüllte Repräsentationslücke von (kulturtheoretisch gesprochen) Subalternen, die nicht nur nicht sprechen, sondern daher auch von gesellschaftlicher Rrepräsentation ausgeschlossen sind. Denn inmitten des musealen Neorenaissancebaus mit seinen hier eingebauten zurichtenden White-Cube-Techniken, inmitten ihrer männlichen Familienmitglieder, denen sie vertraut wie auch bestimmt Anweisungen gibt und unter lautstarken Schreien wie „They say that gipsies steal.“ zertrümmert sie stereotype Narrative, zerlegt Logiken von Sprach- und Wertproduktionen und füllt Repräsentationsleerstellen. Sie praktiziert laut, grell und eindeutig die Emanzipation und Widerständigkeit des in ihrem Kleid unzweifelhaft weiblich zu lesenden Körpers, indem sie sich nicht in vorgegebene familiäre, geschlechtliche, strukturelle, semantische, kulturelle und kulturbetriebliche Hierarchien einfügt, sondern indem sie selbst performativ (Re)Präsentationen herstellt, die gängige Blickregime aushebeln. Für diese Anliegen unterstützt sie auch strukturell-nachhaltig, zum Beispiel mit der Gründung von „Get The Heck To School“ 2017, einer Stiftung für die Ausbildung von Romnja, aber auch mit verbal ermächtigenden Statements wie: „Ich glaube, dass die Rom:nja im 21. Jahrhundert die sozialen, ökologischen und technologischen Avantgardist:innen dieses Planeten sind. Seit etwa 100 Jahren recyceln wir Abfälle, um uns als unterdrückte Minderheit in der westlichen Moderne selbst zu versorgen – die erst jetzt den moralischen, sozioökonomischen und ökologischen Wert dieser Praxis erkennt.“ >> Es funktioniert, statt dass es nicht funktioniert: Kleidung in der unterkühlten brutalistischen Architektur der Wichern-Kirche, elektronische Medien in der prachtvoll geschmückten Backsteinkirche St. Jakobi, Bio-Lebensmittel in der Evangelisch-reformierten Gemeinde, die ihren Ort in einem umgebauten Stadtpalais gefunden hat, Ruhe- und Rückzugsmöbel in den leeren, weiß geschlemmten, gotischen Kirchenschiffen St. Petris. Christian Jankowski, Initiator des Kunstprojekts „Heilige Geschäfte“ berichtet, er hätte eineinhalb Jahre für die Umsetzung dieser Idee in Lübeck aufwenden müssen, die er im Auftrag der Overbeck-Gesellschaft entwickelt hatte. Viele Kirchen in der Innenstadt hätten gezweifelt oder erste Zusagen zurückgezogen, viele Geschäfte hätten nach anfänglichem Interesse ihre Skepsis mitgeteilt und seien abgesprungen. Übrig blieben drei Kichen in der Lübecker Innenstadt und eine in Lübeck Moisling sowie vier Unternehmen: das Familientextilunternehmen Holtext, der Lübecker compustore JessenLenz, das genossenschaftlich organisierte Bio-Lebensmittel-Unternehmen Landwege und das skandinavische Designunternehmen Bolia. Jankowski hätte das Thema in Lübeck selbst gefunden: Die dominierende Präsenz der sieben Kichtürme im Stadtbild der Hanse- und Handelsstadt Lübeck ließen ihn über das Thema nachdenken. Dass er Überzeugungsarbeit leisten musste und zum Teil auch erfolglos blieb, verwundert, drängen sich doch weitaus mehr Gemeinsamkeiten von Kirche und Handel auf als Unterschiede, die aber offenbar nicht in den Konsens gelangt sind: Der Handel erwirtschaftete das Finanzkapital für den Bau der Kirchen; sowohl die Kirchen als auch die Geschäfte sind Orte der Begegnungen; beiden Orten droht eine Bedeutungslosigkeit und beide suchen nach ihren Zukünften; Kirchen und Geschäfte sind Bühnen, Liturgien, Dramaturgien; sie sind Orte der Medienvielfalt; an beiden Orten werden Kapital und Werte geschöpft, verteilt und geschätzt, an beiden Orten wird im Sinne von curare (pflegen) kuratiert; symbolische Formen finden wie Performances hier und da statt, ebenso wie Tauschgeschäfte und Kommunikation; es gibt sowohl einen Fetischismus in der Religion, indem bestimmte Gegenstände verehrt werden, als auch einen Warenfetischismus, der ein quasireligiöses Verhältnis zu Produkten aufbaut; sowohl Kapitaltransferprozesse als auch -zirkulationen (Bourdieu) finden an beiden Orten statt … Daher wundert es auch nicht, dass die Besucher*innenbücher voller Lob über die Kooperationen zwischen Kirchen und Geschäften sind: Man hätte sich gleich beim Reingehen wohl und zu Hause gefühlt, eine beeindruckende Ausstellung, eine einmalige Idee, Kommerz und Glaube sei ein „uraltes Thema“, „toll und mutig“, „anregende Gespräche“, „trotz der Widrigkeiten ein großes und gelungenes Projekt“, „danke“. Auch die Pastoren erzählen angeregt von den 14 Tagen des Projekts „Heiligen Geschäfte“ (vom 22.10. bis 5.11.2023): Für Pastor Bernd Schwarze ist seine Kirche wie die Kunst ein „Andersort“, Pastor Christian Gauer öffnen sich mit den Geschichten automatisch theologische Fragen, für Pastorin Imke Akkermann-Dorn geht es um rücksichtsvollere Lebensweisen. Jankowski hat allen Beteiligten einen räumlichen, zeitlichen und narrativen Rahmen gegeben, um Perspektiven einzunehmen, Anekdoten zu erzählen oder aus der Bibel zu zitieren. Jankowskis „Heilige Geschäfte“ finden ihren konzisen Platz inmitten seiner bisherigen künstlerischen Projekte, in denen konzeptuell eine „Übergriffigkeit“ eingebaut ist: Für „Kunstmarkt TV“ ließ er sich 2008 auf Einladung der Art Cologne vom Format des Homeshoppings inspirieren, zwei TV-Moderator*innen des Senders QVC priesen Kunstwerke von Franz West, Vanessa Beecroft und anderen in Sprache, Rhetorik und Habitus des Live-TV-Shopping an und verkauften sie über eine Telefonhotline. Für „The Perfect Gallery“ wurde Jankowski 2010 von der Londoner „Pump House Gallery“ eingeladen, pimpte hier die Galerieräume im Stil einer „Home-makeover-Show“, indem er die Fußleisten entfernen, das Lichtsystem vereinheitlichen, den Holzboden erneuern und schließlich die Wände mit der extra angemischte Wandfarbe „Jankowski Perfect Gallery White“ streichen ließ. Für „Casting Jesus“ ließ er 2011 im Stil einer Casting Show 13 Schauspieler für die Rolle des Jesus vortragen, um eine Jury aus Mitgliedern des Vatikans den perfekt segnenden, Kranke heilenden, Brot brechenden und betenden Jesus finden zu lassen. Weitere Informationen: https://www.luebeck-tourismus.de/kultur/veranstaltungen/heilige-geschaefte „Bei der Erkundung verschiedener Artefakte in der Hamburger Kunsthalle habe ich mich gefragt, ob die von mir geschaffenen Kunstwerke und Geschichten aus dieser Welt oder von einem anderen Ort stammen.“ So schreibt Walid Raad auf S. 24 seines begleitenden Booklets zur Ausstellung „Cotton Under My Feet: The Hamburg Chapter“ in der Hamburger Kunsthalle, das nicht zufällig dem Format eines begleitenden Programmhefts für ein Theaterstück ähnelt. Selbst dieses Zitat lädt zu Spekulationen ein: War Walid Raad in Hamburg? Handelt es sich um Artefakte (in) der Hamburger Kunsthalle? Wurden die hier signifizierten Kunstwerke tatsächlich von Walid Raad geschaffen? Welche anderen Orte mögen gemeint sein, von denen die Kunstwerke stammen könnten? Raad wurde laut Wikipedia und anderer Quellen im Netz 1967 in Chbanieh im Libanon geboren, lebt in USA und lehrt an der The Cooper Union in New York. Auf seiner Webseite gibt Raad neun unterschiedliche Biografien zu seiner Person an, darunter 4 Fotografien, ein Interview, drei klassische Biografien mit unterschiedlichen Namen, Geburtsorten und -zeiten sowie Behelfssätze mit Freilassungen zur eigenen Verfügung: „Walid Raad is an ______ and an ______ (______, ______).“ Seine Werke sind seit der Documenta11, spätestens seit der dOCUMENTA (13) bekannt: Auf der Enwezor-documenta11 2002 erzählte er mit dem fiktionalen Kollektiv The Atlas Group die Gegenwartsgeschichte des Libanons, aufbauend auf dem Archiv der Atlas Group, das in drei unterschiedliche Kategorien von Akten gegliedert präsentiert wurde: „Typ A (verfasst), Typ FD (gefunden) und Typ AGP (Atlas Group Productions)“. Das Archiv wies sich darüber als eine Konstruktion aus, die uneindeutig, oszillierend und anfällig für Manipulationen durch zum Beispiel politische und geopolitische Interessen ist. Auf der d13 realisierte er, gemeinsam mit anderen von ihm kreierten fiktionalen Personen mit „Scratching on Things I Could Disavow“ ein Kunstprojekt über die Geschichte der Kunst in der „arabischen Welt“, das Raad startete, als 2007 in Städten wie Abu Dhabi, Dubai, Sharjah etc. neue Kulturstiftungen, Galerien, Kunstschulen, Magazine, Messen, Biennalen, Museen und Fonds gegründet wurden. Er schlug vor, nun in „islamisch“, „modern“ und „zeitgenössisch“ zu klassifizieren. Allein die Tatsache, dass für Raads Werke verschiedene „Autoren“ angegeben wurden und werden, stellt/e die kanonischen Vorstellungen von Künstlersingularität, Originalität, Wahrheit, Geschichte, Archiv und Dokumenten gründlich in Frage. Nun also Hamburg: Im Anschluss an die beinahe gleichnamige Ausstellung 2021/22 für das Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid erweitert Raad diese Ausstellung um das „Hamburg Chapter“. Sicher wäre es möglich, an dieser Stelle das Textformat einer Ausstellungskritik fortzusetzen und den Plot zu erzählen, die Relationen nachzuzeichnen, den Sachgehalt in Faktentreue zu skizzieren. Stimmiger wären folgende Angaben: Walid Raad: „Cotton Under My Feet: The Hamburg Chapter“, Handlung in drei Akten 1. Akt: 1. Etage in der Lichtwark-Galerie der Hamburger Kunsthalle, Alte Meister, Raum 12 und 7 2. Akt: Treppenhaus der Lichtwark-Galerie: Vor dem Eingang zum Kupferstichkabinett und Rotunde 3. Akt: Erdgeschoss, Transparentes Museum, Raum 64, 61, 60 und 57 Akteur*innen: Ich (Walid Raad), Künstler Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, Industrieller, Kunstsammler Francesca Thyssen-Bornemisza, Tocher, Sammlerin Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza, Ehefrau, Sammlerin Lamia Antonova, beste Restauratorin ihrer Generation, palästinensisch-sowjetischer Herkunft John Constable, Künstler Caspar David Friedrich, Künstler Eastman Johnson, Künstler Martin Johnson Heade, Künstler Gilbert Stuart, Künstler Jalal Toufic, Schriftsteller Winslow Homer, Künstler Andrew Crispo, Kunsthändler mit dunklem Geheimnis Samuel Morse, Erfinder des Telegrafen und Maler Béhague Sangusko, ein sog. Perserteppich, 16. Jahrhundert, 510 x 275 cm, Baumwolle, 21 kg schwer, gefühlt 1 Tonne, der schwerste Teppich der Welt, von Baron Thyssen-Bornemisza 1992 der Kunsthalle Hamburg gestiftet, aufgrund seines Gewichts nicht ausstellbar verschiedene Gemälde: u.a. 7 Gemälde mit gemalten Wolken auf der Rückseite, vertraglich festgelegt, dass nur die Rückseite dieser Gemälde betrachtet und als Fotografie gezeigt werden dürften u.a. 23 amerikanische Gemälde des 19. Jahrhunderts Fotoalbum der Innenräume der Villa Favorita in der Schweiz Bücherbestand der Hamburger Kunsthalle zum Thema Vampirismus 285 Engel 10 Pokale aus der Gold- und Silbersammlung des Barons mit Gliederfüßern 9 psycho-pathologische Zustandsberichte von Gemälderahmen, erstellt von Lamia Antonova TBA2, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary in Madrid Hamburger Kunsthalle und das „Transparente Museum“ Aus diesen Akteur*innen spinnt Walid Raad eine nicht (oder kaum) verifizierbare komplexe und unüberschaubare Geschichte, die uns durch die Sammlungsräume des historischen Gründungsbaus der Hamburger Kunsthalle führt: Beginnend in der oberen Etage bei den Alten Meistern kombiniert Raad den Sammlungsbestand mit Schenkungen, Leihgaben (zum Beispiel aus dem Museum für Kunst und Gewerbe) und eigenen Werken, ohne dass eine eindeutige Zuordnung möglich wäre, und führt uns durch das Gebäude, das Treppenhaus, vorbei am Eingang des Kupferstichkabinetts, unterhalb der Deckenmalerei von Gerhard Merz, entlang an der Bleiskulptur „Der Fluss“ von Maillol und Couturier von 1939/43, durch die kuppelbekrönte Rotunde mit ihren ionischen Säulen bis in das „Transparente Museum“ im Erdgeschoss. Raad erweitert/e den Gang um eine tatsächliche und eine virtuelle Performance-Tour per App durch seine Ausstellung. Erzählt wird die Geschichte der Sammlung des Schweizer Unternehmers und Kunstsammlers Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, die dieser 1992 in Teilen der Kunsthalle Hamburg geschenkt haben soll. Erzählt wird deren Provenienzen und Konservierungen, Familiengeschichten und Finanzturbulenzen, eingebettet in historische Kontexte wie Sklaverei, Zuckerhandel, Kalter Krieg und Klimakrise. Daher hieße es weiter: Konzept: Walid Raad Regie: Walid Raad Autor*innen: Walid Raad, in Zusammenarbeit mit Petra Roettig, Leona Marie Ahrens, Selvi Göktepe Kuration: Petra Roettig, Leona Marie Ahrens, Selvi Göktepe Bühne: Hamburger Kunsthalle, in Zusammenarbeit mit Walid Raad Dramaturgie: Walid Raad, in Zusammenarbeit mit Hamburger Kunsthalle Produktion: Hamburger Kunsthalle, in Kooperation mit Kampnagel Sommerfest Raad gibt damit einen museologisch-performativen Ausblick auf das, was Museum auch sein kann: Szenisch kuratierte und aufbereitete Verwicklungen von Museumssammlungen und ihren Zeit-, Finanz- und persönlichen Kontextgeschichten, kombiniert mit konkreten Situiertheiten und Ortsspezifizitäten. Im „Transparenten Museum“ geht es an der kanonischen Videodokumentation Andrea Frasers vorbei, die 1989 mit ihrem „Museum Highlights: A Gallery Talk“ im Philadelphia Museum of Art als Museumsführerin Jane Castleton auf einem Rundgang durch das Museum die Operationsweise des Museums sowie die Interrelationen zwischen Klasse, Geschmack, Habitus, Philanthropie und öffentlicher Politik freilegte. Raad trifft eine andere konzeptionelle Entscheidung: Er dekonstruiert nicht die Mechanismen, die Sprache und den Habitus des White Cube, er verstrickt die durch die Institutionskritik dekonstruierten Konstituierungsfaktoren des White Cube zu einer Konstruktion, die sich der bisher kunsttheoretisch erarbeiteten Intelligibilität entzieht. Künstlersingularität, Originalität, Wahrheit, Geschichte, Archiv und Dokumente sind over, die Theorie muss aufholen. Uraufführung: 10.08.2023 Laufzeit: bis 12.11.2023 Performances-Tour mit Walid Raad: 16 Termine im August und jeweils 6 Termine im September, Oktober und November 2023 Artist Talk: 9.11.2023, 19 Uhr Weiteres Bildmaterial >> 40 Premierenbesucher*innen – von Teenagern bis zu älteren Personen – sitzen in dem Aufenthaltsraum einer Werkhalle auf dem ehemaligen Thyssen-Krupp-Gelände in Hamburg Altona, nachdem sie ihre Taschen, Jacken und Telefone haben abgeben müssen. Signa hat zu der Uraufführung ihrer inzwischen fünften experimentellen Performance-Installation oder auch installativen Performance in Hamburg, diesmal mit dem Titel „Das 13. Jahr“ eingeladen. Die Premierenkarten der Schauspielhaus-Produktion sollen in wenigen Minuten verkauft worden sein, die nächsten Veranstaltungen sind bis in den Dezember, knapp vor Weihnachten ausverkauft. Denn es hat sich rumgesprochen: Signa, das Künstler*innenpaar Signa und Arthur Köstler, wird in eine ihrer phantasievoll magischen und geschlossenen Erlebniswelten entführen, die sich zwischen Theater und anderen szenischen Künsten, zwischen Installation, Performance und Happening aufhalten und die für immer den Blick auf das, was wir Realität nennen, verändern (werden). Heute würden wir eine „Lethe-Simulation“ erleben [Anmerkung: Lethe bedeutet Vergessen, Vergessenheit, auch im Sinne von Verborgenheit.]. Drei in grau gekleidete Kolleg*innen des Lethe-Servicepersonals informieren uns in einem Informationsraum, der sich später als nüchterner Transitraum zwischen unserer Welt und Signas Welt herausstellen wird. In administrativer Sprache wird uns, begleitet von einer Diashow von Landschaftsfotografien, in vier Punkten das Setting der nun folgenden Stunden vorgestellt: Wir sollen uns in uns selbst zurückversetzen, in das Alter eines 12-jährigen Kindes. Wir würden mit 39 anderen Kindern eine Gruppenfahrt auf den „Hasenhof“ unternehmen, irgendwann und irgendwo würde der Bus in einer lichten Waldlandschaft von Nebel umringt sein, der Busfahrer würde verschwinden und wir wären auf uns allein gestellt. Durch einen Tunnel würde unser 12-jähriges Ich im Nirgendwo landen. Wenn wir diese Simulation unterbrechen wollten, würden Alarmknöpfe dies ermöglichen. Dabei würde alles den Status derselben Realität besitzen, ein Käse oder ein Brot aus Plastik wären gleich einem richtigen Käse oder einem richtigen Brot zu behandeln. Wir sollen spüren! Die Performance beginnt: Wir werden aufgefordert, uns zu erheben und dem Simulationsteam der Reihe nach durch einen engen Gang zu folgen. Wir landen in der kühlen, Nebel gefüllten Industriehalle, in der eine düstere Bergansiedlung installiert wurde, bestehend aus scheinbar unzähligen kleinsten Holzhütten (es sind zehn), auf die Wände sind Gebirgspanoramen gemalt, der Betonfussboden ist mit Steinbrocken aus Pappmaché und mit Geröll bedeckt, die Decke ist abgehängt, wie Nebel drückt sie von oben und macht den Raum eng. Nebelkrähen krächzen in der Ferne, Wölfe heulen, ein Gewitter scheint sich zu nähern, es ist kühl, sehr kühl, der Raumplan des Bergdorfes macht eine Orientierung beinahe unmöglich. Wir irren schnell zwischen den vielen kleinen Buden, verlieren unsere Ordnung und uns damit in uns selbst. In und vor den Hütten sitzen, liegen oder stehen Wesen, womöglich die Bewohner*innen der Hütten, ihre Gesichter sind durch Masken aus Pappmaché mit starrem Blick verdeckt. Es ertönt ein Gong, wir werden von Personen gegriffen und einzeln in die Hütten entführt. Hier wird das ganze Ausmaß deutlich: Wir, die Ferien-, jetzt Notkinder, haben uns in ein Nebeldorf retten können. Wie wir sind auch dessen Bewohner*innen schon vor einigen Jahren hier gestrandet, nur Erwin hätte hier gewohnt, viele seien inzwischen gestorben, das Nebelfieber würde allen gesundheitlich zu schaffen machen. Wir müssen unsere Kleidung wechseln, denn die alte sei feucht und klamm, unsere Schuhe seien untauglich, das Leben in den Bergen zu bewältigen. Die sichtbaren Unterschiede zwischen dem Schauspielensemble und dem Publikum werden damit nivelliert. Unsere beschwichtigenden Sätze, dass wir ja bald wieder auf dem Weg nach Hause seien, werden müde von den Bewohner*innen weggelächelt, man solle sich auf einen längeren, ja lebenslangen Aufenthalt einstellen. Sie selbst hätten schon alles versucht, den Ausweg zu finden, aber viele seien entweder bei dem Versuch zu fliehen verschwunden, der Nebel hätte sie verschluckt oder sie seien demütig, aber fieberkrank zurückgekommen und damit todgeweiht. Nur zwei Personen wüssten den Weg, eine davon die Hausiererin des Dorfes. Hier schon befinden wir uns inmitten unserer persönlichen Settings: Die 40 Premierenbesucher*innen sind in zehn Familienkonstellationen aufgeteilt, die die Mitglieder des Signa- und des Schauspielhaus-Ensembles zusammen mit lebensgroßen, versehrten und daher pflegebedürftigen Puppen performen. Die Hütten sind eng, höchstens acht Quadratmeter Grundfläche, das Wenige, das zur Verfügung steht, wird offenherzig mit uns geteilt, die Kücheneckbank wird auch als Schlafstätte genutzt, daneben eine kleine Kochecke, in der Kartoffeln gegart werden, die gegen Schminkutensilien eingetauscht werden konnten, im Hinterzimmer stehen ein Sofa, ein Sessel und ein Vitrinenschrank – alles karg, abgenutzt, zeitlos, trist und grau wie die Kleidung, die wir gewechselt haben. Dieses Setting wird für die nächsten viereinhalb Stunden unsere Heimstätte werden. Ich werde erfahren, dass Marina, Ende zwanzig, junge Mutter, ihr Leben nur mit Alkohol erträgt, als Vater der acht Monate alten Lilly, die selbst schon am Nebelfieber erkrankt ist, zwei Männer aus der Dorfgemeinschaft in Frage kommen. Marina will gleichzeitig wissen und nicht wissen, wer der Vater ist. Marinas Bruder Marius, Teenager, hat weder Lust auf Schule noch auf Familie, er ist immer hungrig und immer wütend. Vanessa, etwas jünger als Marina, schnitzt sich (wie viele andere im Dorf) mit Rasierklingen, „um das Unglück loszuwerden“, sie kümmert sich um ihre bettlägerige Schwester Valentina, ihr Vater ist auf den Berg gegangen und von hier nicht mehr zurückgekehrt. Beide jungen Frauen konkurrieren, wer die Attraktivere sei, beide übernehmen die Verantwortung, die Kleinfamilie am Leben zu erhalten. Unsere Gespräche beginnen mit dem Trösten über den Verlust unserer Herkunftsfamilien und damit auch über die eigenen Eltern im Alter von 12 Jahren (bei allen offenbaren sich disruptive Familienverhältnisse). Es werden Alltagsroutinen in den Hütten starten und damit Gemeinschaftspraktiken stattfinden, und es werden Ausflüge in das Dorf und zu den Nachbarn folgen, um in das trübe soziale Gefüge und ihre nebulösen Beziehungen einzutauchen: Erwin, der Dorfälteste, der mit seinem Dialekt eine Bergweltatmosphäre verströmt und in seiner Eigenheit als Autorität akzeptiert wird; Walter, dessen Frau als lebensgroße Puppe in einem Rollstuhl vor der Hütten lebt und der aggressiv und übergriffig ist; Bert, der spannert und dafür die ersehnten Zigaretten oder Schnaps tauscht; seine Frau Hannah, die davon weiss; Angelina, die im Dorf offenbar mit Drogen dealt; Norma, die Lehrerin im Dorf, die in der Nacht ihre Tränen nicht unterdrücken kann; die Hausiererin, die am Rande des Dorfes unter einem Lager aus drapierten Tüchern, Fellen und Knochen campiert – es eröffnet sich ein hallengroßes, dezentrales Setting und wir als 12-Jährige mittenrein geworfen, aber ebenso eingewoben in einen riesigen Sozialplot der einzelnen Kleinfamilien, der Verbindungen unter den Familien und ihrer Schicksale, verwoben in vielzähligen Macht- und Gewaltformen innerhalb von Familien und Lebensgemeinschaften, in Sehnsüchten, Hoffnungen, Projektionen, Phantasmen und Widerständen. Ein Mal wird zwischendrin die Simulation unterbrochen. Ein Vertreter des Simulationsteams kommt in die Hütte und fragt (und erinnert damit noch einmal an das Setting des Experiments), was notwendig wäre, um die Simulation unseres 12-jährigen Ichs zu verstärken. Wir können zwischen einem Ereignis oder einer wahrsprechenden Glaskugel wählen. Wir entscheiden uns für das Ereignis und wenig später wird Vanessa Blut spucken, wir werden um ihr Leben bangen und noch enger zusammenrücken. Zwischenzeitlich ertönt regelmäßig ein Gong, die Bewohner erstarren in ihrer jeweiligen Pose und über eine Lautsprecherdurchsage erfahren wir, dass nun ein neuer Akt beginnen wird: dass wir vom Nachmittag in den Abend, vom Abend in die Nacht wechseln würden, dass die Geister kämen, dass ein Gewitter drohe … So vergehen gefühlt Stunden um Stunden, da wir alle Utensilien an der Garderobe haben abgeben müssen und damit offenbar auch unser Zeitgefühl (tatsächlich waren es viereinhalb Stunden). Da das Dorf im Nebel liegt, gibt es keine Unterscheide zwischen Tag und Nacht, zwischen Tages- und Nachttemperaturen. Alles ist dunkel, trist, grau, kalt und nebelig. Hin und wieder sind Schreie zu hören, krächzende Nebelkrähen und andere Tiere in der Ferne, der um die Hütten wehende Wind. In den Häusern werden über Alltagsrituale familiäre Bindungen performiert: über Geheimnisse, gemeinsame Ungerechtigkeiten und Phantasien, vertrauliche Ausflüge, Gute-Nacht-Geschichten, familiäre Sorgen und Ängste, zelebrierten Aberglauben, gemeinsames Kartoffelschälen, über Kartoffelstampf am Abend und Haferbrei mit Schokolade am Morgen, über Füßebaden in Plastikkinderbadewannen, über sich wiederholende Erinnerungen, die das Mit-Sein herstellen. Und wenn man sich anfänglich nicht auf die Simulation eingelassen haben sollte, dann täte es die Zeit, denn die Behandlung des Gegenübers von sich als 12-jährigem Kind informiert über die Fremdbilder von 12-Jährigen und hinterlässt Spuren im eigenen Verhalten. Unser jetziges Ich versucht, nicht nur das damalige Ich reflexiv und/oder imaginativ herzustellen und zu performieren, sondern beobachtet neugierig das antizipierte und/oder erinnerte damalige Ich, um innerhalb dieses spekulativen Wiederherstellungs- und Wiedererkennungsprozesses immer wieder zu scheitern – kommt doch das jetzige Ich in die Quere. Damit befinden wir uns inmitten der Performance-Installation oder der installativen Performance inmitten einer nächsten Dynamik, nämlich eines Re- und eines Pre-enactments: Wir enacten uns als ein Ich, das re-, aber auch pre-enactet wird, das wieder-(ge)holt, aber auch vor-gefühlt wird. Identität entsteht, so lässt sich ableiten, in einem Dazwischen, wird (von sich und anderen) zugeschrieben, projiziert, erwartet und kontrolliert, fühlt sich fremd und vertraut an und ist als konsistente und kontinuierliche Größe unerreichbar. Das Ich ist offenbar eine Praktik auf verschiedenen Zeitschienen, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Personenkonstellationen und Situationen, mal funktioniert diese Praktik besser, mal schlechter, mal wird sie als richtig anerkannt und mal auch nicht, mal ist sie als eine soziale Anwendung kongruenter mit dem Umfeld, mal entgleist sie zwischen den vielen und unterschiedlichen Erwartungen, auch an sich selbst. Wenn sie zwischen diese Einflussgrößen zu korrespondieren in der Lage ist, scheit sich so etwas wie Glück einzustellen. Die Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Ein lebensbedrohliches Gewitter wird heraufziehen, wir werden, um zu Überleben, aufgefordert, einen metrischen Reim aus vier Zeilen zu lernen, der die „Habergeiss“ austreiben können soll. Ein Prozessionszug aller Beteiligten wird sich formen, der durch das Dorf ziehen und laut, groß und gemeinschaftlich in der Angst gegen den drohenden Sturm ansingen wird, begleitet von Pauken, Geigen und Gitarren, angeführt durch ein übergroßes Fell-Fabelwesen mit Pferdekopf. Die Halle wird dröhnen und hallen, inmitten des Nebels und der Angst vor dem bedrohlichen Gewitter wird sich die mitternächtliche Gemeinschaft formen und widerständig gegen die Naturgewalten tanzen. Das dramaturgische Finale ist fühlbar gekommen, wir flüchten uns in unserer gemeinschaftlichen Angst vor der Bedrohung in unser Heim und – werden durch eine Lautsprecherdurchsage abrupt desillusioniert: Wir werden aufgefordert, uns umzuziehen und von dem Simulationsteam durch den Tunnel zurückführen zu lassen. Es heisst Abschied nehmen, die Mitglieder unserer Heimatfamilie haben sich ihre Masken wieder über die Gesichter gezogen und sind in die Starre ihrer Pose gefallen. Dadurch wird uns eine Verabschiedung unmöglich gemacht [Marina, Marius und Vanessa – es war schön bei euch]. Die abschließende Rückverwandlung im Transitraum, in dem anfänglich über die Simulation informiert wurde, fällt ebenso sperrig aus: Zwei der Dorfbewohner, unter anderem Erwin, der uns mittlerweile vertraute Dorfälteste, drängen in unsere Ausnüchterungszelle, wollen sich uns anschließen und ebenfalls die geschlossene Kunstwelt verlassen, werden aber vom Servicepersonal zurückgedrängt. Sollen wir uns nicht für sie einsetzen? Gehören wir nicht zusammen? Damit scheitert die behauptete Entsimulation, die unseren ganzen Körper und seine Einzelteile, so das Personal des Simulationsunternehmens Lethe, von unseren Eindrücken befreien sollte. Lethe entschuldigt sich für die Störung. Und so werden wir dann auch aus der Halle entlassen: Signa wird uns in unseren Leben nie mehr ganz verlassen… Signa: Das 13. Jahr, Uraufführung 21.10., 18:30 Uhr, Halle 7, Waidmannstraße 26 (ehemaliges Thyssen-Krupp-Gelände), https://schauspielhaus.de/stuecke/das-13-jahr Das Konzept erarbeiteten Signa und Arthur Köstler. Regie führte Signa Köstler. Für die Bühne waren zuständig: Lorenz Vetter, Signa Köstler und Tristan Kold. Die Kostüme erdachten Signa Köstler und Tristan Kold. Für Sounddesign war verantwortlich: Christian Bo Johansen. Die Bühnentechnik koordinierte Simon Urbschat. Es spielen: Amanda Babaei Vieira, Hans-Günter Brünker, Cara Golisch, Ute Hannig, Sachiko Hara, Martin Heise, Daniel Hoevels, Kaspar Jöhnk, Lotte John, Minna John, Arthur Köstler, Signa Köstler, , Tristan Kold, Tom Korn, Benita Martins, Mara Nitz, Josef Ostendorf, Denis Po?e?, Linn Reusse, Lars Rudolph, Lucie Rudolph, Agnieszka Salamon, Sonja Salkowitsch, Jolina Schick, Andreas Schneiders, Joelina Spieß, Bettina Stucky, Julie Stüven, Livia Szabo, Luisa Taraz, Luise Thiele, Lorenz Vetter, Lara-Marie Weine, Mareike Wenzel, Luna Worthmann, Martha Zonouzi Weitere Besprechungen: https://www.ndr.de/kultur/Urauffuehrung-Das-13-Jahr-des-Kollektivs-SIGNA,audio1492406.html Steven Cohen: Put your heart under your feet… and walk! To Elu Die Hinterbühne des Berliner Festspielhauses klappt sich auf wie ein Notebook: Auf dem Boden liegt ein symmetrisch sortiertes Raster aus etwa zweihundert hellrosa farbenen Spitzenschuhen mit ihren Satinbändern, paarweise geordnet, manche mit Davidsternen kombiniert, mit Kruzifixen oder mit Voodoo Puppen, andere mit Amuletten, Spielzeugautos oder Sexspielzeugen. Links auf der Bühne sind vier Grammophone in eine Runde gehängt, rechts auf der Bühne ist eine Gruppe verschiedener Art déco Kerzenständer, inklusive hochgestreckter Kerzen, zusammen mit einem Tisch zu einem Altar angeordnet. Die Rückwand der Bühne wird im Verlauf der einstündigen Performance zu einer Projektionsfläche für vorproduzierte Videos an „anderen Orten“. Der gesamte Raum ist in den Geruch von Weihrauch gehüllt. Steven Cohen, bildender und darstellender Künstler, Performancekünstler und Choreograf, 1962 in Südafrika geboren, weiss, jüdisch, männlich, homosexuell, hat seit den 1990er Jahren einen alterslosen, haarlosen, artifiziell geschminkten und geschmückten, weiß gepuderten, beinahe nackten, queeren Archetyp entwickelt, der mittels seines Körpers als Mittler oder auch Médiateur die auf der Bühne installierten und figurierten Objekte „zum Leben erwecken wird“: Hier wird der material-semiotische Ansatz z. B. Bruno Latours, der die Handlungs- und Wirkvollmächtigkeit (Agency) nichtmenschlicher Entitäten oder auch der Dinge in einem interaktiven Netzwerk von Akteur*innen betont, oder auch der neo-materialistische Ansatz Karen Barads der Intra-Aktion, der die wechselseitige Hervorbringung miteinander verschränkter Agenzien herausstellt, aus denen sich prozesshaft Materie performiert und damit auch erst materialisiert, zur Ansicht gebracht. Die installative Collage auf der Bühne, bestehend aus hunderten Einzelteile, über Licht bedeutungsvoll als Reliquien ins Szene gesetzt, sind daher bereits Mitspieler. Damit liegt schon in der Installation das Performative, schon bevor Cohen die Bühne betritt. Cohen wird sich über etwa 60 Minuten in langsamen und würdevollen Schritten, manchmal hilflos, manchmal ungleichgewichtig, durch diese intra-performative Installation bewegen. Sein weißer Körper wird in weißen Corsagen oder kunstvollen Art déco-Kleidern gezwängt sein. Er wird sich auf glitzernden, überhohen High Heels, in Spitzentechnik bewegen, deren Absätze anfänglich Kindersärge sein werden. Verlängerte Unterarmgehstützen werden ihm dabei behilflich sein, mit den Kindersärgen unter seinen Füßen über den drapierten Spitzenschuhen zu balancieren und die Installation zu durchschreiten. Die vier Grammophone werden durch eine Kurbel von ihm aktiviert, an seinen Körper geschnallt über die Bühne getragen und damit zu tanzenden Lautsprechern. Er wird als Trauerritual die Kerzen entzünden, ein Gebet flüstern, mit einer Kamera eine Schatulle inspizieren, aber auch seinen weiß geschminkten und mit Ornamenten geschmückten Körper, seine glitzernden Augen und seine kunstvoll nachgezogenen Lippen, um mit der Kamera dann auch in seinen Rachen zu gleiten. Er wird über das „Theater als Tempel“ referieren, aus der Schatulle einen Löffel Asche seines 2016 verstorbenen Partners Elu Johann Kieser zu sich nehmen und aus einem Kelch trinken. Dazu wird leise Leonard Cohen singen. Und er wird sich über die auf der Rückwand projizierten Videos selbst begegnen, in einem Palmengarten, aus „Muttererde“ auftauchend, in einem Schlachthof: Hier wird das Publikum die Tötung von Rindern sehen, Cohen wird sich in seinem weißen Spitzentutu unter die bluttropfenden, langsam sterbenden Rinderkörper legen, er wird seinen weißen Körper mit dem roten Rinderblut waschen. Im Schlachthof angestellte People of Color werden sich wundern und 17 Zuschauer*innen werden sich diesen Bildern entziehen. Damit wird die performative Installation, durch Cohen als Médiateur performiert, kinematografisch angereichert. Cohen bzw. sein kreierter Archetypus wird dem Publikum (s)ein geheimnisvolles, phantastisches (oder auch phantasmatisches), verschlüsseltes Universum für einen Moment öffnen: ein Universum, das mit Symbolen, Metaphern, Chiffren und Zeichen ausgestattet ist, das mit Ritualen, Licht, Sound, Bewegungen, Weihrauch und künstlichem Nebel als geheimnisvoll und intim inszeniert wird, das aber auch ohne die Hermeneutik als Methode zugänglich und attraktiv ist: Wie Alice im Wunderland durchschreitet und zelebriert Cohens Kunstfigur eine Kapelle der Schmerzen – Schmerzen, die durch Tod, Verlust oder Misshandlung, durch körperliche Züchtigungen, Trauer oder Religionen, durch Nichtwissen, Angst und Liebe entstehen. Aber Cohens Kapelle tröstet über überwältigende Trauer hinweg: „Put your heart under your feet… and walk!“ Sein Universum lässt, obwohl übercodiert und chiffriert, Platz für eigene Projektionen. Bei Projektionen wird es bleiben, denn das Publikum wird die collagierte Bodeninstallation nach 60 Minuten nicht noch selbst durchwandern können. Die Kapelle bleibt damit ansichtige Zeremonie und Bild/Leinwand. Sie ist Elu gewidmet. Auftakt der Performing Arts Season der Berliner Festspiele. Ein Panorama internationaler Tanz-, Theater- und Performanceaufführungen, 13.10.2023 bis 8.3.2024: https://www.berlinerfestspiele.de/performing-arts-season Gastbeitrag von erwin GeheimRat Als Lovis Corinth, Max Klinger, Walter Leistikow, Alfred Lichtwark, Max Liebermann, Max Slevogt und weitere 1903 in Weimar den Deutschen Künstlerbund gründeten, taten sie dies inmitten der Reglementierungen im Kaiserreich unter anderem mit dem Ziel, die Kunstfreiheit einzufordern. Auch für mich war das ein wichtiger Grund, mich für eine Mitgliedschaft in dieser 1936 erzwungen aufgelösten und dann 1950 wieder begründeten Vereinigung von in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Künstler:innen zu interessieren. Denn rechtliche Themen, insbesondere Verfassungsrecht und die Stellung der Kunstfreiheit begleiten meine künstlerischen Praktiken sowohl im- als auch explizit seit vielen Jahren. Im Zusammenhang verschiedener auf der documenta fifteen 2022 in Kassel präsentierter Arbeiten wurden neben den medial erhobenen Anschuldigungen auch von Politiker:innen zum Teil eigenwillige Grenzziehungen der Kunstfreiheit behauptet, so dass ich nicht nur für Kunstschaffende etwas zur tatsächlich rechtlichen Einordnung beisteuern möchte. Im Grundgesetz ist in Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 die Freiheit der Kunst als ein Grundrecht unserer Verfassung verankert. Nähere Einordnungen ergeben sich aus Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts, dessen Entscheidungen gemäß § 31 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 Grundgesetz bindend sind sowohl für die Legislative, die Exekutive als auch die Judikative, das heißt für Parlamente und deren Abgeordnete, für Behörden, Staatsanwaltschaften, Ministerien, Beamt:innen, Minister:innen, Bundeskanzler:innen, Bundespräsident:innen sowie für Richter:innen und Gerichte. In der Mephisto-Grundsatzentscheidung (BVerfGE 30, 173) hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1971 verdeutlicht, dass Art. 5 Abs. 2 GG gewisse Einschränkungen vorsieht, diese aber nur auf die in Art. 5 Abs. 1 verbriefte Meinungs-, Informations-, Presse- und Rundfunkfreiheit und nicht auf die in Art. 5 Abs. 3 genannten Freiheitsrechte für Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre anzuwenden sind. Sofern gesetzliche Bestimmungen auf der sogenannten Einfachgesetzesebene nun Grundrechte einschränken sollen, müssen nach Art. 19 Abs. 1 GG die Grundrechte unter Angabe des Artikels in dem Gesetz genannt werden. Im Grundsatzurteil BVerfGE 83, 130 hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass dies nicht für Grundrechte gilt, die nicht eingeschränkt werden dürfen. Zu diesen nicht einzuschränkenden Grundrechten zählt das Bundesverfassungsgericht die Kunstfreiheit. Um die Kunstfreiheit zu begrenzen, bedarf es damit mindestens einer Bestimmung, die sich unmittelbar aus der Verfassung beziehungsweise in aller Regel sogar aus konkurrierenden Grundrechten herleiten lässt; solchen Rechten also, die auf einer vergleichbar erhabenen Position unserer Verfassung positioniert sind. Wird zum Beispiel die mit Art. 1 Abs. 1 GG verbriefte Menschenwürde durch ein künstlerisches Werk potentiell verletzt, dann handelt es sich um ein konkurrierendes Grundrecht, das sich auf der Einfachgesetzesebene bereits eingeschrieben haben kann. Im Fall der Menschenwürde ist dies erkennbar etwa mit Regelungen zu Volksverhetzung in § 130 des Strafgesetzbuches geschehen. Bei vollständiger Durchsicht dieses Paragraphen zeigt sich allerdings, dass analog zu § 86 Abs. 4 StGB in Abs. 7 Ausnahmen für Abs. 2, welcher für zahlreiche künstlerische Praktiken zutreffend ist, eingezogen sind: Die Strafandrohungen sollen nicht gelten, „wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient“. Die gesetzgebende Legislative hat mit diesen Bestimmungen auf der Einfachgesetzesebene festgelegt, wann volksverhetzende Inhalte, die „in Schriften, auf Ton- oder Bildträgern, in Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Verkörperungen enthalten sind oder auch unabhängig von einer Speicherung mittels Informations- oder Kommunikationstechnik übertragen werden“, strafbar sind. Demzufolge sind sie es nicht im Rahmen einer Handlung, die „der Kunst […] dient“. Wenn der Jurist Peter Raue in seinem Beitrag zur documenta fifteen in der Süddeutschen Zeitung vom 23.06.2022 schließlich erklärt, „[v]erfassungswidrige und strafrechtlich relevante Arbeiten haben in Deutschlands Öffentlichkeit nichts zu suchen“, dann kann das zwar als eine Meinungsäußerung Raues durchgehen, genau betrachtet zeigt sich darin wohl selbst eine verfassungswidrige Position. Denn mit der geltenden Rechtslage in Deutschland hat es in dieser Absolutheit wenig zu tun. Es gibt Strafrechtsnormen, die sich schwerlich aus der Verfassung herleiten lassen und damit nicht gegen die Kunstfreiheit rivalisieren können. Im Fall des § 130 StGB zu Volksverhetzung hat die Gesetzgebung, wie dargelegt, Ausnahmen unter anderem im Rahmen der Kunst vorgesehen. Und es existieren Verfassungsbestimmungen, die nicht in Konkurrenz zum Grundrecht der Kunstfreiheit treten und diese somit ebenfalls nicht überragen können. In der Entscheidung 1 BvR 1738/16 von 2019 hat das Bundesverfassungsgericht darüber hinaus verdeutlicht, dass nicht nur das Herstellen, sondern auch das Ausstellen von Kunst durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geschützt wird: „Die Kunstfreiheitsgarantie betrifft in gleicher Weise den ‚Werkbereich‘ und den ‚Wirkbereich‘ künstlerischen Schaffens. Nicht nur die künstlerische Betätigung, sondern darüber hinaus auch die Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks sind sachnotwendig für die Begegnung mit dem Werk als eines ebenfalls kunstspezifischen Vorgangs. […] Die Anerkennung von Kunst darf nicht von einer staatlichen Stil-, Niveau- und Inhaltskontrolle oder von einer Beurteilung der Wirkungen des Kunstwerks abhängig gemacht werden.“ Die Freiheit der Kunst als ein Grundrecht in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, war auch den Erfahrungen während des Deutschen Kaiserreichs und des Nationalsozialistischen Regimes geschuldet. Es würde mich wundern, wenn Liebermann, Corinth, Slevogt und die anderen, die 1903 den Deutschen Künstlerbund auch mit dem Ziel, die Kunstfreiheit einzufordern, gründeten, die heute tatsächliche Rechtslage nicht schätzen und verteidigen wollten. Zum Autor: erwin GeheimRat arbeitet im Bereich digitale Konzeptkunst und ist ordentliches Mitglied des Deutschen Künstlerbund e.V. Guest article by erwin GeheimRat When Lovis Corinth, Max Klinger, Walter Leistikow, Alfred Lichtwark, Max Liebermann, Max Slevogt and others founded the Deutscher Künstlerbund in Weimar in 1903, they did so amid the regimentations of the German Empire, partly with the aim of demanding artistic freedom. For me, too, this was an important reason for becoming interested in a membership of this association of artists living in the Federal Republic of Germany, which was dissolved by force in 1936 and then re-established in 1950. For legal issues, especially constitutional law and the position of artistic freedom have accompanied my artistic practices both im- and explicitly for many years. In relation to various works presented at the documenta fifteen 2022 in Kassel and additionally to accusations made in the media, politicians have also drawn the boundaries of artistic freedom in a partly idiosyncratic way, so that I would like to contribute something for actual legal classification, and not only for artists. Article 5 (3) sentence 1 of the German Basic Law enshrines the freedom of art as a fundamental right of the constitution. More detailed classifications result from the case law of the Federal Constitutional Court, whose decisions are binding for the legislative, the executive and the judiciary, i.e. for parliaments and their deputies, for authorities, public prosecutors, ministries, civil servants, ministers, Federal Chancellors, Federal Presidents, judges and courts, in accordance with Section 31 (1) of the Federal Constitutional Court Act in conjunction with Article 1 (3) of the German Basic Law. In the Mephisto landmark ruling (BVerfGE 30, 173), the Federal Constitutional Court made it clear as early as 1971 that Article 5 (2) of the German Basic Law provides for certain restrictions, but that these are to be applied only to freedom of expression, information, the press and broadcasting guaranteed in Article 5 (1) and not to the freedoms of art, science, research and teaching mentioned in Article 5 (3). If statutory provisions at the so-called simple law level are now to restrict fundamental rights, Article 19 (1) of the German Basic Law requires, that the law has to specify the basic right affected and the article in which it appears. If, for example, human dignity, which is guaranteed by Article 1 (1) of the German Basic Law, is potentially violated by an artistic work, then this is a competing fundamental right that may already have inscribed itself at the level of simple law. In the case of human dignity, this is recognizably the case, for example, with regulations on incitement to hatred in § 130 of the Criminal Code. However, a complete review of this section reveals that, analogous to Section 86 (4) of the Criminal Code, exceptions for subsection (2), that applies to numerous artistic practices, have been included in subsection (7): The threats of punishment should not apply „if the act serves civic information, to prevent unconstitutional activities, to promote the arts or science, research or teaching, reporting about current or historical events, or similar purposes.“ With these provisions, the legislative body has determined at the simple-law level when inciting content that is „contained in writings, on audio or visual media, on data carriers, in images or other materialised content or which is also transmitted independently of any storage using information or communication technologies“ is punishable. Accordingly, they are not if the act „serves […] the arts […]“. When the jurist Peter Raue finally declares in his contribution to documenta fifteen in the Süddeutsche Zeitung of June 23, 2022, „unconstitutional and criminally relevant works have no place in Germany’s public sphere“ [free translation], then this can pass as an expression of opinion by Raue, but if you look at it closely, it probably shows an unconstitutional position itself. Because it has little to do with the current legal situation in Germany in this absoluteness. There are criminal law norms that can hardly be derived from the constitution and thus cannot rival artistic freedom. In the case of Section 130 of the Criminal Code on incitement to hatred, the legislation, as explained, has provided for exceptions in the context of art, among other things. And there are constitutional provisions that can not compete with the fundamental right of artistic freedom and thus cannot override it either. In the 2019 decision 1 BvR 1738/16, the Federal Constitutional Court further clarified that not only the producing but also the exhibiting of art is protected by Article 5 (3) sentence 1 GG: „The guarantee of artistic freedom concerns in equal measure the ‚area of the work‘ and the ‚area of effect‘ of artistic creation. Not only the artistic activity, but also the presentation and dissemination of the work of art are necessary for the encounter with the work as a process that is also specific to art. […] The recognition of art may not be made dependent on governmental control of style, level, and content or on an assessment of the effects of the work of art.“ [free translation] Including the freedom of art as a fundamental right in the German Basic Law of the Federal Republic of Germany was also due to the experiences during the German Empire and the National Socialist regime. I would be surprised if Liebermann, Corinth, Slevogt and the others who founded the Deutscher Künstlerbund in 1903 – also with the aim of demanding freedom of art – did not appreciate and would defend the actual legal situation. About the author: erwin GeheimRat works in the field of digital conceptual art and is a full member of the Deutscher Künstlerbund e.V. Stalk ist eine französische TV-Serie von Simon Bouisson und Jean-Charles Paugam, deren erste Staffel mit 10 Folgen in der ARD-Mediathek zu finden ist. Bisher gab es in diesem Blog keine TV-Kritiken, aber zu dieser Serie ist eine solche angebracht. In der deutschen Fernsehlandschaft sind in den letzten Jahren einige Versuche unternommen worden, Digitalisierung, Hacking oder Coding in Filmbildern zu fassen, oft mit bescheidenem Erfolg, mitunter wirkten Drehbuch und Regie eher hilflos, wie etwa bei der Serie Hackerville um den rumänischen Jung-Hacker Cipi, die zu allem Überfluss auch noch mit einem Grimme-Preis bedacht wurde. Das ist bei Stalk anders. 10 Folgen in einer Länge von je 23 min bringen nicht nur technische Details des Codings in den Handlungsablauf mit ein, die Serie schafft es auch, Bilder zu produzieren, die mit digitalen Welten und Digital-Ästhetik in Form zahlreichen Rear-Kamera-Aufnahmen eine bisher ungekannte Fernsehkompatibilität herstellt. Musik und auch Sound-Design sind genauso eng mit der qualitativ hochwertigen Umsetzung verknüpft, wie Drehbuch, Regie und das erfrischende Schauspiel der verschiedenen Akteure dieser Serie; allen voran die beiden Hauptfiguren Théo Fernandez in der Rolle des Hackers Lucas alias Lux und Carmen Kassovitz als die von mindestens zwei jungen Männern begehrte Kommilitonin Alma. Lucas startet gerade sein Informatik-Studium und wird mit allen übrigen Stalken ist also Programm bei dieser herausragenden TV-Serie, die so auch hochaktuelle Themen wie pervasives Filmen und Fotografieren sowie die nahezu unbegrenzte Anwesenheit von Smartphones in allen Lebensbereichen verarbeitet. https://fr.wikipedia.org/wiki/Stalk 2021 GeheimRat solicited comments from experts at the United Nations (OHCHR, UNCOPUOS, UNOOSA), the ETO Consortium, NASA, ROSCOSMOS, ESA, CNSA, and from the legal field as part of the funded conceptual art work UniBase#no.6173. The subject is the 2020 announcement that Elon Musk had hired SpaceX’s general counsel to draft a constitution for the planet Mars: „I’m actually working on a constitution for Mars. No country can claim sovereignty over heavenly bodies“ (David Anderman, former SpaceX General Counsel, 2020). Comments received were forwarded to the General Counsel, Vice President, COO, and SpaceX CEO Elon Musk, who were also asked for their assessments. Fundamental to all activities in space, according to the comments received, are the Outer Space Treaty of 1967, the United Nations Charter, and international law. The claim of sovereignty, such as the installation of a constitution, by a single nation or by non-state legal entities (such as the SpaceX company) would consequently be unlawful (see Art. II, VI and VIII Outer Space Treaty). Incidentally, if one of the contracting states (currently 110) fears interference with the use and exploration of outer space and celestial bodies, it may request consultations on planned undertakings and experiments (Article IX Outer Space Treaty). Web: https://6173.GeheimRat.com 2021 hat GeheimRat im Rahmen dieser geförderten Konzeptkunst-Arbeit Grundlegend für alle Aktivitäten im Weltraum sind den eingegangenen Befürchtet übrigens einer der Vertragsstaaten (aktuell 110) KONTAKT: Web: https://6173.GeheimRat.com/de/De-MontageHarald HakenbeckMilan PeschelMord im RegionalexpressPeter im TierparkPeter und der WolfPost-Postdramatisches TheaterPostdramatisches TheaterRambaZamba TheaterRolf LudwigRZt
Kultische Kapelle: Kunst, Empathie und Liturgie





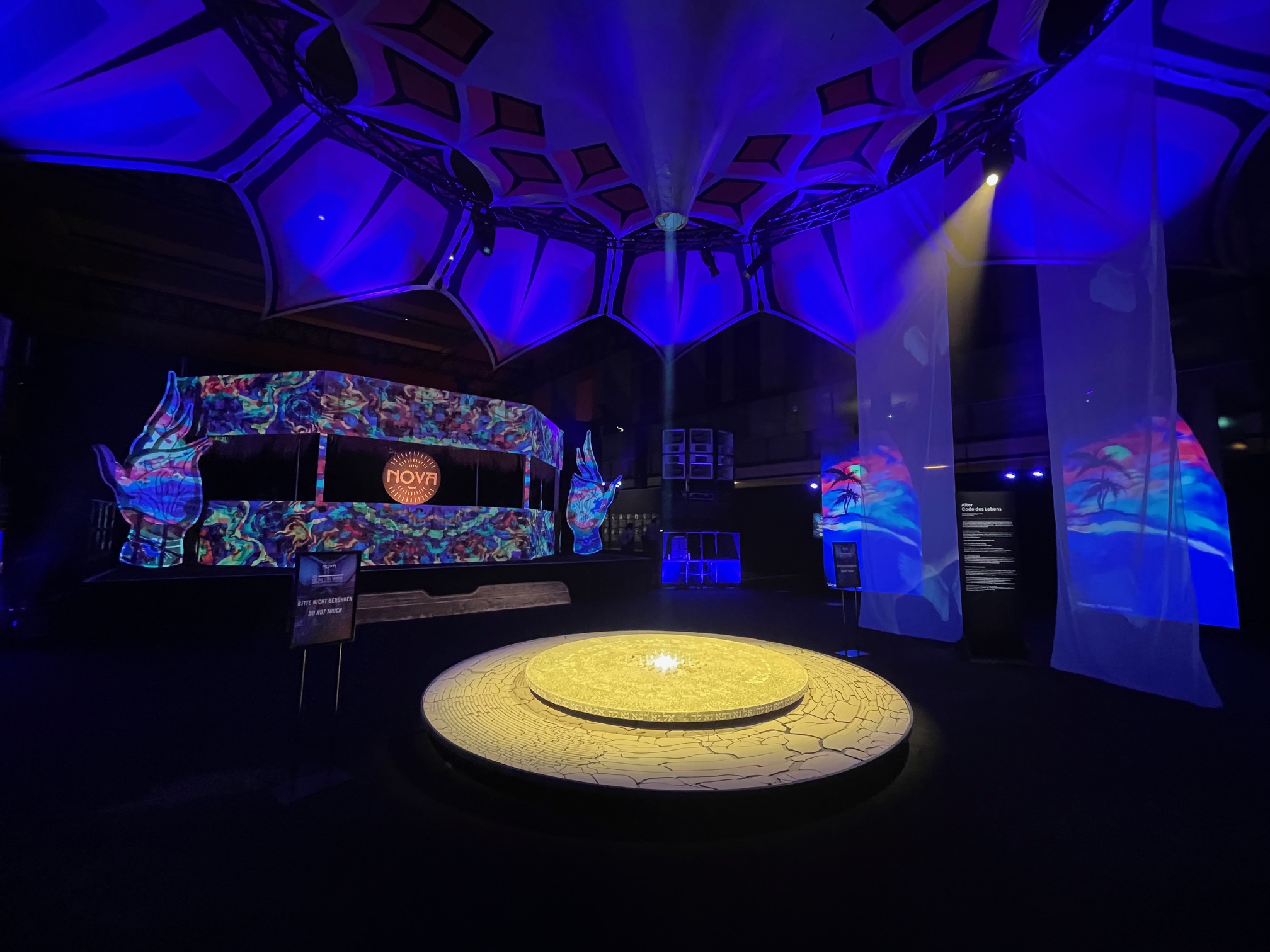





EschkolFlughafen TempelhofGaza EnvelopeMassakerNovaNova Music FestivalOct 7Open Air-Trance-MusikfestivalThe Nova ExhibitionTribe of Nova FoundationWe Will Dance Again
Kein Sehnsuchtsort in Sicht? Zwischen der schönen neuen Welt und der alten Welt entdeckt William Kentridge Martinique – und den Surrealismus.

„The Great Yes, The Great No“ wurde nun im Rahmen der Performing Arts Season im Berliner Festspielhaus aufgeführt. Ihre Uraufführung hatte die Oper im Sommer 2024 als Auftragsarbeit der LUMA Foundation, Arles auf dem Festival Aix-en-Provence mit Unterstützung verschiedener US-amerikanischer Institutionen (Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, CAL Performances, Berkeley, Brown Arts Institute der Brown University, The Roy Cockrum Foundation u.a.) und Galerien (Goodman Gallery, Lia Rumma Gallery und Hauser & Wirth).


Nhlanhla Mahlangu, Phala O. Phala, Luc de Wit – Co-Regie
Nhlanhla Mahlangu – Chor-Komponist
Greta Goiris – Kostümdesign
Sabine Theunissen – Bühnenbild
Tlale Makhene – Musikalische Leitung
Mwenya Kabwe – Dramaturgie
Urs Schönebaum, Elena Gui – Lichtdesign
Žana Marovi?, Janus Fouché, Joshua Trappler – Projektion (Schnitt & Mischung)
Duško Marovi? SASC – Kamera
Kim Gunning – Videosteuerung
Gavan Eckhart – Sounddesign
Ein Projekt des Centre for the Less Good Idea
Tour in Partnerschaft mit QuaternaireAndré BretonBerliner FestspielhausBlackfaceCapitaine Paul-LemerleFrantz FanonLévy-StraussMartiniqueNégritudePerforming Arts SeasonSurrealismusThe Great Yes The Great NoWilliam Kentridge
Wenn das Re- zum Preenactment wird …




KontakthofKontakthof - Echos of '78Meryl TankardPina BauschPina Bausch TanztheaterRolf BorzikTheatertreffenWuppertal
Kinematografisch-theatrische Experimentalität





Bernarda Albas HausFederico García LorcaHamburger SchauSpielHausKatie MitchellTheatertreffenTheatertreffen 2025
Tanzhermeneutisches – danke an die Trisha Brown Dance Company




Barnett NewmanBerliner FestspieleGlacial DecoyIn the FallKasimir MalewitschNoe SoulierPerforming Art SeasonsRobert RauschenbergTrisha BrownTrisha Brown Dance CompanyWorking Title
Was „ohne Titel (10.000 Watt)“ von Ioannis Oriwol war, ist und sein wird. Eine Geschichte in drei Akten.





Ioannis OriwolLichtsäuleohne Titel (10.000 Watt)Spiegelscheinwerfer
special project: Der Bau
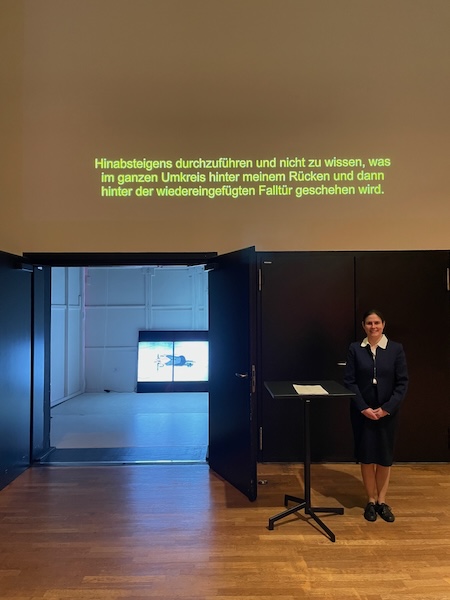




Closed CircuitJerzy GrotowskiKafkaspecial project: Der Baustudio.boxTarane BazrafshanTheater Erfurt
Immer Theater mit der Kunstfreiheit


Mediale Translationsleistungen durch Reenactments.





https://taz.de/Palaestina-Protest-bei-Kunstaktion/!5991553/
Das ist (k)eine Botschaft. Taiwan inmitten repräsentativer Zeichenspiele.



Berliner FestspieleBotschaftBubble TeaCeci n'est pas une pipeRepublik ChinaRimini ProtokollStefan KaegiTaipehTaiwan
Mikropolitiken groß gemacht.









Dana Michels Living Intra-Actions. Oder: Die Poesie des Einpackvorgangs eines Bürostuhls.




Selma Selmans veränderte Repräsentationspolitiken


Christian Jankowskis konzeptuell eingebaute „Übergriffigkeit“















Walid Raad. Die Theorie muss aufholen









Signas Kraft der Behauptung







Kapelle der Schmerzen



Crying Classroom program October & November 2023
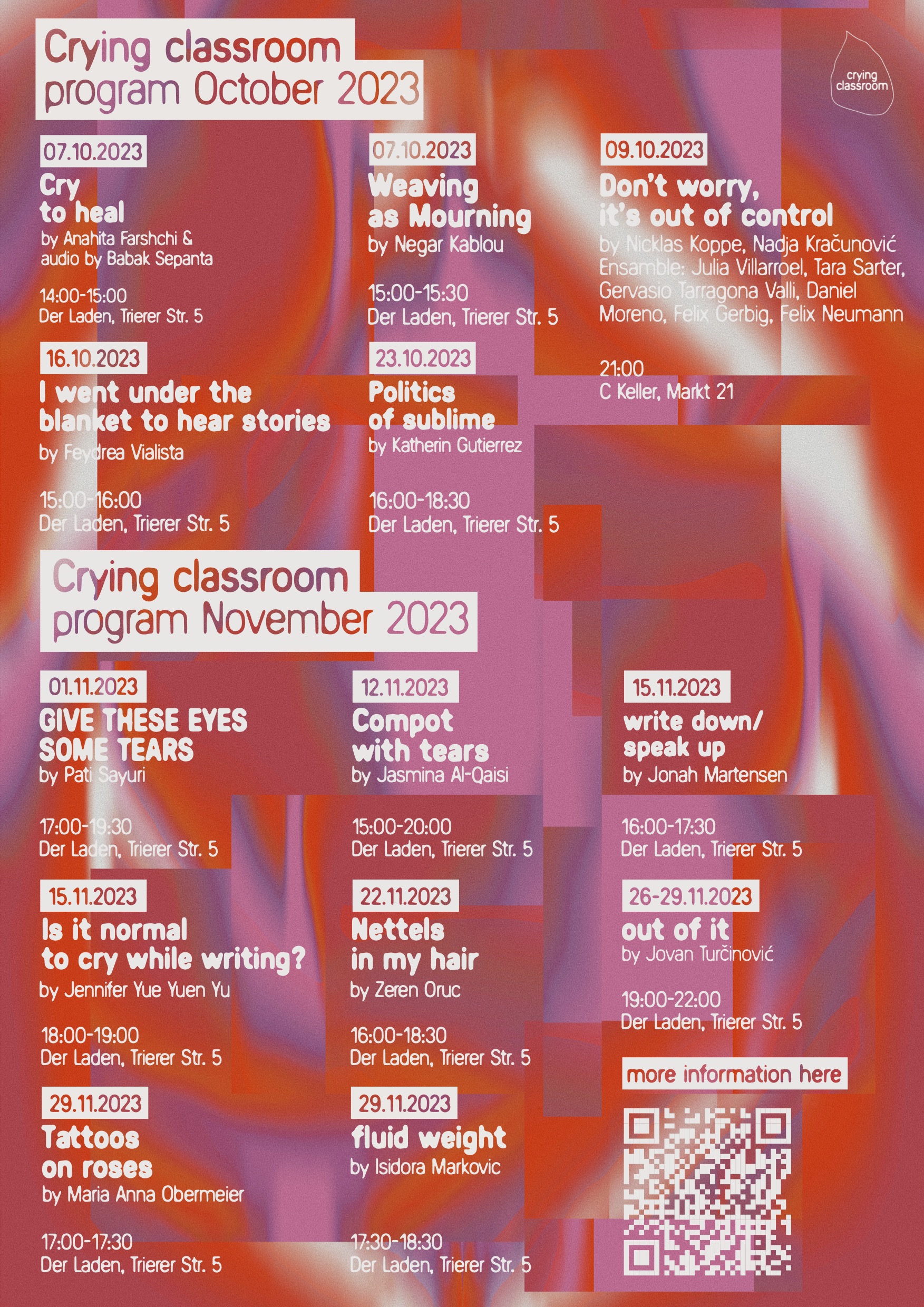
Tatsächliche Grenzen der Kunstfreiheit in Deutschland
Um nicht missverstanden zu werden, per se glaubensfeindliche und rassistische Positionen gehören für mich zu verstörenden Formen menschlicher Begegnung und gleiches gilt für das Infragestellen des Existenzrechts von Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Das sollte aber nicht dazu verleiten, die auch hierzulande rechtlichen Grenzen der Kunstfreiheit anders zu zeichnen, als sie es historisch begründet und demokratische Rechtsstaaten konstituierend sind.
Actual Limits of Artistic Freedom in Germany
In order not to be misunderstood, positions that are per se hostile to faith or racist belong to disturbing forms of human encounters for me and the same applies to questioning the right to exist of member states of the United Nations. However, this should not tempt us to draw the legal boundaries of artistic freedom in a different way than they are historically justified and constitute democratic constitutional states.
In the landmark ruling of BVerfGE 83, 130, the Federal Constitutional Court stated that this does not apply to fundamental rights that may not be restricted. The Federal Constitutional Court considers the freedom of art among these fundamental rights that may not be restricted. In order to limit artistic freedom, at least one provision is required that can be derived directly from the constitution or, as a rule, from competing fundamental rights, i.e., rights that are positioned in a comparably elevated position in the constitution. Stalk – Coding mit Serienreife

Erstsemestern bei der Aufnahme durch Studierende höherer Semester mit der Zahl PI konfrontiert. Nacheinander sollen die Erstsemester eine weitere Ziffer nach dem Komma benennen. Lucas sagt nicht nur die nächste Zahl, er kann und setzt zunächst noch zögerlich, aber dann schier unendlich fort und beendet damit die Competition.
Ob sein anfängliches Zögern schon die Vorahnung war, dass Brillianz regelmäßig Gegner produziert, erfüllt sich dies in der Figur des Fachschaftssprechers Alex, gespielt von Pablo Cobo, der Lucas auf einen Stuhl gebannt inmitten der feiernden Menge und nach reichlich Alkohol auch noch sein Urinat zu trinken verpflichtet. Nicht genug der Demütigung filmt er das Ganze und stellt es online dem gesamten Campus zur Verfügung.
Lucas ist allerdings nicht nur mit der Zahl PI vertraut, sondern auch mit dem Coden und Hacken. Für ihn ist kein Problem, sich aus seinem schlichten Studenten-Zimmer im Wohnheim in Laptop und Smartphone seines Widersachers einzuhacken und über die integrierten Kameras in die Welt von Alex und vielen weiteren einzutauchen und einzuweben.Elon Musk, the law and Mars – UniBase#no.6173



CONTACT:
artLABOR e.V.: press@artlabor.eyes2k.net ph: +49.(0)3212.1031038 or
GeheimRat.com: studio@GeheimRat.com ph: +49.(0)3212.1031065
Download text and images [3,6MB]: https://download.GeheimRat.com/artL_PR_en_UniBase6173.pdfElon Musk, das Recht und der Mars – UniBase#no.6173
Expert:innen der Vereinten Nationen (OHCHR, UNCOPUOS, UNOOSA), des ETO-Konsortiums, von Weltraumagenturen und aus dem Rechtsbereich um Stellungnahmen gebeten. Gegenstand ist die 2020 bekannt gewordene Ankündigung, Elon Musk habe den Chefsyndikus von SpaceX beauftragt, eine Verfassung für den Planeten Mars zu entwerfen. Die eingegangenen Kommentare wurden an den Chefsyndikus, den Vizepräsidenten, den COO und an den CEO von SpaceX, Elon Musk weitergeleitet und auch diese wurden um ihre Einschätzungen gebeten.
Stellungnahmen zufolge der Weltraumvertrag von 1967, die Charta der
Vereinten Nationen und das Völkerrecht. Die Beanspruchung von Hoheitsgewalt, wie etwa das Installieren einer Verfassung, durch eine einzelne Nation oder durch nichtstaatliche Rechtsträger (wie z.B. das Unternehmen SpaceX) wäre folglich rechtswidrig (siehe Art. II, VI und VIII Weltraumvertrag).
Beeinträchtigungen der Nutzung und Erforschung des Weltraums und der
Himmelskörper, so kann er Konsultationen über geplante Unternehmungen und Experimente verlangen (Art. IX Weltraumvertrag).
artLABOR e.V.: press@artLABOR.eyes2k.net ph: +49.(0)3212.1031038 oder
GeheimRat.com: studio@GeheimRat.com ph: +49.(0)3212.1031065
Download Text und Bilder: https://download.GeheimRat.com/artL_PR_de_UniBase6173.pdfZur Kommunikation zeitgenössischer Kunst | For communication of Contemporary Art
